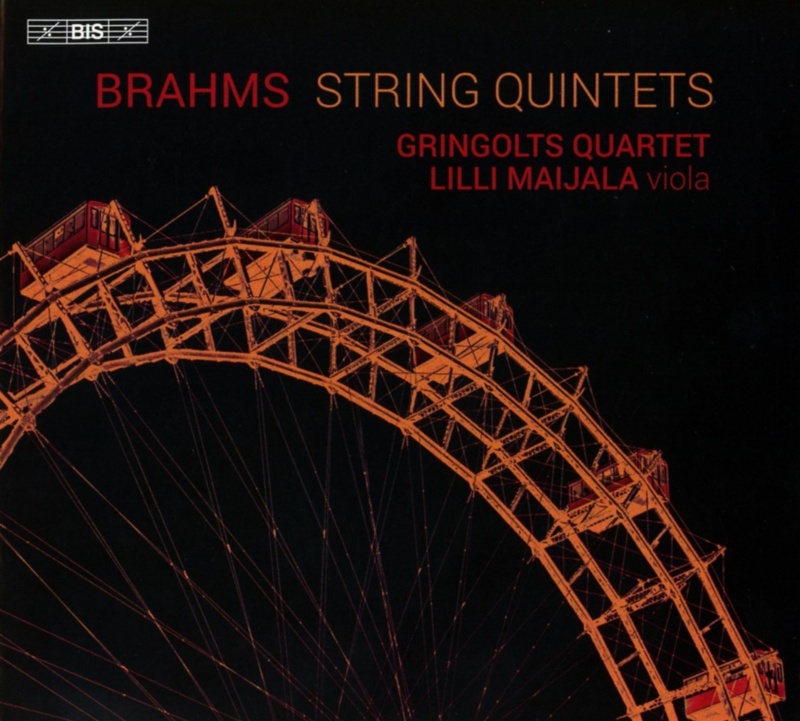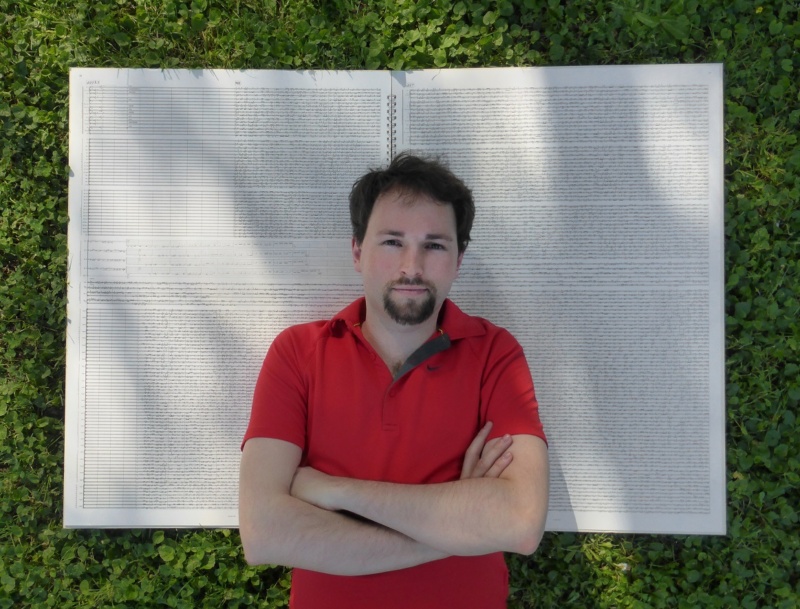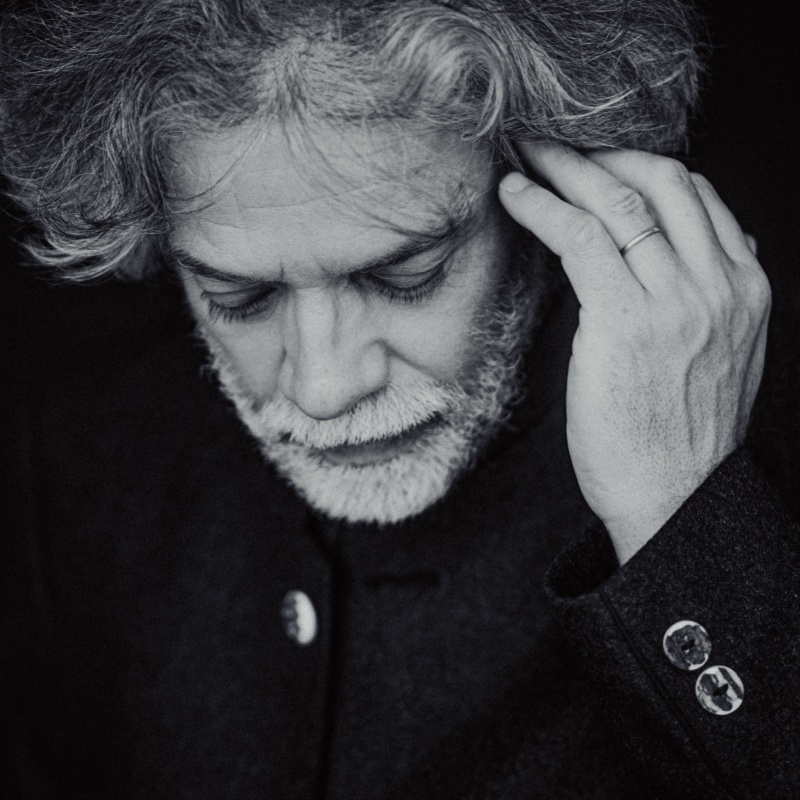Nur wenige Monate nach dem Erfolg ihrer Oper Infinite Now, die gerade durch die Kritikerumfrage des Magazins Opernwelt zur Uraufführung des Jahres gekürt wurde, kam am 22. Oktober 2017 ein neues Werk von Chaya Czernowin zur Uraufführung: Das Cellokonzert Guardian wurde im Rahmen der Donaueschinger Musiktage von Séverine Ballon und dem SWR Symphonieorchester unter Pablo Rus Broseta aus der Taufe gehoben und ist am 17. November erneut in Luxemburg zu erleben. Doch was hat es mit diesem Namen auf sich? Bezieht er sich auf eine britische Tageszeitung, oder soll gar ein Schutzengel angerufen werden? Die Komponistin lacht angesichts dieser Assoziationen und erklärt: „Namen dienen manchmal einfach als Inspirationsquelle. Das kann der Klang sein oder eine Assoziation, die dabei hilft, dem eigenen Schaffen eine Farbe zu verleihen.“
„In diesem Fall liegt im Namen eine Art Anforderung oder Wunsch. Ich habe Guardian geschrieben, nachdem ich Infinite Now beendet hatte, als Folge sozusagen. Obwohl es in Infinite Now am Ende einen Hoffnungsschimmer gibt, ist die Oper düsterer geraten als ich erwartet hatte. Also ist in meiner Vorstellung Guardian ein Gesuch nach einer Kraft, die uns schützt, eine Erzählung über ein nicht-religiöses Gebet.“ Das Cellokonzert als Reaktion also auf ein eigenes Werk, in dem Chaya Czernowin ein Thema gründlich erforscht: Infinite Now zeigt aus multiplen, auch textlich durch unterschiedliche Quellen gespeisten Perspektiven eine unendlich dehnbar erscheinende Zeit angesichts katastrophaler Ausweglosigkeit. Eine Erzählung der chinesischen Autorin Can Xue war dafür ebenso Grundlage wie Luk Percevals Drama Front, seinerseits nach Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues entstanden.
Trotz der im Schaffensprozess empfundenen Nähe zur Oper stellt das Cellokonzert natürlich eigene formale Anforderungen. „Auf den ersten Blick kommt es ganz traditionell daher: Das Solo-Cello erklingt nach einem Teil, den man als Einleitung sehen könnte, und es scheint eine Kadenz am Ende des Stückes zu geben“, erklärt die Komponistin. „Aber das täuscht. Die ‚Kadenz’ zum Beispiel ist keine virtuos-improvisatorisch daherkommende Zusammenschau des vorigen Materials. Sie ist ein ganz neuer Ort, an dem die Hoffnungslosigkeit sich lichtet. Wenn man etwas immer und immer wieder wiederholt und dabei langsamer und langsamer wird, bekommt es plötzlich eine lyrische Qualität. Die Stelle ist eine Art Nachsatz über die Hoffnungslosigkeit, und ein Gefühl von Erkenntnis beginnt aufzuscheinen. Diese Quasi-Kadenz mündet dann nicht in eine Coda, sondern das ganze Orchester ergießt sich in einem riesigen Block hinein – und plötzlich endet das Stück, wie inmitten eines Staus. Obwohl also das, was man in der Partitur sieht, zu einem gewissen Grad den normalen formalen Anforderungen entspricht, werden diese transformiert.“
Künstlerische Partnerin in diesem Transformationsprozess ist Séverine Ballon, mit der Chaya Czernowin seit etwa 2008 befreundet ist. Damals spielte die Cellistin einen der Soloparts in Chaya Czernowins bei der Münchener Biennale im Jahr 2000 mit riesigem Erfolg uraufgeführten Oper Pnima. „Ich kenne ihr Spiel und ihre Persönlichkeit extrem gut und konnte mich deshalb beim Schreiben stark davon inspirieren lassen, wer sie ist und wie sie mit ihrem Instrument umgeht“, erklärt die Komponistin. „Normalerweise bringen die Leute, mit denen ich arbeite, nicht nur herausragende solistische Fähigkeiten mit, sondern auch eine ganz individuelle Herangehensweise an ihr Instrument. Fast, als sei es Teil ihrer Persönlichkeit, ein gänzlich individueller Ausdruck ihres Charakters. Dem wende ich mich beim Schreiben zu.“
Von der Wichtigkeit solcher künstlerischer Begegnungen und Kollaborationen berichtet Chaya Czernowin immer wieder – auch mit der Autorin Can Xue zum Beispiel entwickelte sich während der Arbeit an Infinite Now ein enger Austausch. „Es geht dabei nicht nur um Persönliches. Ich glaube, dass jeder schöpferische, offene, erfahrungshungrige Mensch von Begegnungen inspiriert wird. Und auch von Dingen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie oft ich die Stufen fotografiert habe, die zu meinem Haus führen. Sie sind immer ein bisschen feucht, und deshalb wächst etwas Grünliches auf ihnen. Und dieses Grün hat so einen speziellen Schimmer...“
Ein Schimmer, der vielleicht Klang inspirieren kann – vielfach sind es solche in der sinnlichen Erfahrung begründeten Quellen, die Chaya Czernowin in Form synästhetischer Assoziationen nutzt. In ihrem Sprechen über Musik äußern sie sich in vielfältigen Metaphern. „Das hat damit zu tun, was passiert, wenn die Motivation zum Schreiben nicht in erster Linie im Meistern der Virtuosität der Schöpferrolle begründet ist“, holt sie zur Erklärung aus. „Natürlich wünsche ich mir diese Meisterschaft, aber für mich ist es viel wichtiger, Dinge zu entdecken, die ich noch nicht kenne. Und Situationen oder hörbare Eindrücke in die Welt zu bringen, durch die Menschen etwas erfahren können, das im Innersten berührt. Dieses Etwas ist nicht neu, denn es ist in uns, aber es wurde bisher nicht ins Außen geholt. Eine Metapher kann für mich ein sehr bedeutsames und hilfreiches Instrument sein, um an diesen Ort zu gelangen.“
So häufig im Sprechen über ihre Musik verschiedenste Metaphern auftauchen, so zurückhaltend äußert sie sich gewöhnlich über Fragen von Traditionslinien und ästhetischer Zuordnung ihrer Stücke. „Auch wenn man mir Fragen dazu stellt, dass ich eine komponierende Frau bin, oder über mein Jüdisch- oder Israelisch-Sein“, bestätigt und ergänzt sie diese Beobachtung. „Ich bin jemand, der in die Zukunft blickt. Ich habe mir sehr genau mein Elternhaus angesehen, in meiner Oper Pnima und überhaupt in der Zeit, als ich mich mit dem Dehnen von Identitäten beschäftigt habe – eine Reaktion auf meine Herkunft. Ich habe das in den 90ern und frühen 2000ern umfassend bearbeitet: Fluktuationen erzeugt, ein Kontinuum zwischen möglichen Identitäten eines Stückes, eines Instrumentes geschaffen. Aber jetzt haben sich meine Anliegen komplett verändert, während gleichzeitig alles, was ich damals gelernt habe, Teil von mir ist. Mein Schwerpunkt liegt aber nicht dort, wo ich herkomme, sondern dort, wohin ich mich bewege, in was ich mich verwandeln will. Veränderung ist für mich so bedeutsam!“
Ebenso wie ihre künstlerischen Forschungsgebiete sich immer wieder verlagern, hat Chaya Czernowin auch ihren Wohnsitz immer wieder verlegt. Denkbar wäre es also durchaus, ihre künstlerische Suche auch anhand der biografischen Orte zu erzählen, angefangen von ihrer Kindheit in Israel, wo musikalische Mentoren schnell ihre außerordentliche Begabung erkannten. „Von Anfang an war die Musik eine Heimat für mich. Ich dachte immer: Was daran soll denn so schwierig sein? Ich habe ein absolutes Gehör, also konnte ich alle Tonhöhen auch in riesigen Clusterklängen bestimmen. Aber – ich war nicht für die Bühne gemacht.“ Anstatt sich, wie von ihren Lehrern erhofft, auf eine Karriere als Konzertpianistin vorzubereiten, schlug sie einen anderen Weg ein. „In meiner Jugend kamen an den Wochenenden oft an die 20 Leute mit Gitarren, Schlagzeug und so weiter zu mir nach Hause und wir spielten Popmusik. Jahrelang spielte ich auch in Piano Bars. Und dann hatten wir eine Progressive Rock Band. Als ich anfing, Songs zu komponieren, ergab plötzlich alles einen Sinn für mich. Die Musik, die ich schrieb, wurde allerdings immer seltsamer, und die Leute sagten: Chaya, das hier ist keine Popmusik mehr – aber hast Du vielleicht mal was von Webern gehört? Du musst das studieren!“
Und studieren hieß für Chaya Czernowin nicht zuletzt reisen – als DAAD Stipendiatin lernte sie in Deutschland bei Dieter Schnebel, später in New York und San Diego, und sie schloss an ihr Studium eine Phase intensiven Reisens an. Die vielen Einflüsse dieses künstlerischen Weges kann sie, auch wenn ihr kreatives Hier und Jetzt für sie immer im Mittelpunkt steht, klar benennen. „Natürlich wächst niemand im luftleeren Raum auf. Ich sage immer, dass ich widersprüchliche Einflüsse habe. Zum Beispiel die japanische höfische Musik Gagaku – und freie Improvisation. Oder Scelsi – und Feldman. Oder Lachenmann – und Ferneyhough. Aber wenn man mich fragt, in welche Erbfolge ich mich gern einordnen würde, sage ich, ohne prätentiös klingen zu wollen: Ockeghem, Monteverdi, Gesualdo, Scarlatti, Schumann, der späte Beethoven – all diese Künstler, die gegen die Konventionen ihrer Zeit angingen und gegen die Vergangenheit in Richtung Zukunft arbeiteten. Diese Reibung kann man in ihrem Werk erkennen.“ Morton Feldman führt sie dabei als exemplarisch für das Prinzip fortwährender Suche an. „Sein ganzes Leben hindurch erkennt man einen roten Faden bestimmter Fragestellungen, besonders die Temporalität betreffend und wie man erkennt, dass das Material seinen eigenen Willen hat. Das hat er entwickelt, mit wechselndem Fokus. Zum Ende seines Lebens hin hat er die beste Musik geschrieben, weil er nicht an Meisterschaft interessiert war, sondern bis zum letzten Moment entdecken wollte.“
Der Gedanke liegt nah, dass ihr momentaner Wohnort – sie lehrt, nach Professuren in San Diego und Wien, seit 2009 an der Harvard University – auch künstlerisch recht gut zu ihr passen könnte. Der Eklektizismus der Einflüsse und die Ausrichtung auf Erfahrung und Weiterentwicklung verbindet sie schließlich mit amerikanischen Künstlern verschiedenster Disziplinen. Chaya Czernowin bestätigt dies, schränkt aber ein: „Ich suche die Reibung, und das ist ein weniger amerikanisches Konzept. Es hat mehr mit der europäischen Dialektik zu tun. Vielleicht bin ich eine seltsame Reisende in der Hinsicht, dass ich in dieser Dialektik immer das unsichtbare Kontinuum entdecken möchte.“ Denn in seiner Grundform hält sie das rein Dialektische für überholt. „Mit unserer Technologie, unseren Möglichkeiten für High Resolution können wir heutzutage ins Innere schauen und entdecken, wie minutiös alles miteinander verbunden ist.“
Diesen Blick auf die feinen Zusammenhänge, quasi mit hochauflösender Kamera geschossen, kann man sicherlich auch für das große Musiktheaterwerk erwarten, an dem sie zurzeit arbeitet. „Die neue Oper wird wie ein Nachhausekommen für mich sein, zurück zur Intimität und in die psychologischen Gefilde. Infinite Now ist so riesig, es ist meine ganze Weltsicht. In dem jetzt entstehenden Werk komme ich zurück auf eine ganz persönliche Stimme.“
Oktober 2017, Nina Rohlfs
Guardian (2017) für Cello und Orchester
Kompositionsauftrag des Südwestrundfunks, der Philharmonie Luxembourg und des Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
Uraufführung
Séverine Ballon (Cello), SWR Symphonieorchester, Pablo Rus Broseta (Dirigent)
Donaueschingen, Baarsporthalle, 22.10.2017