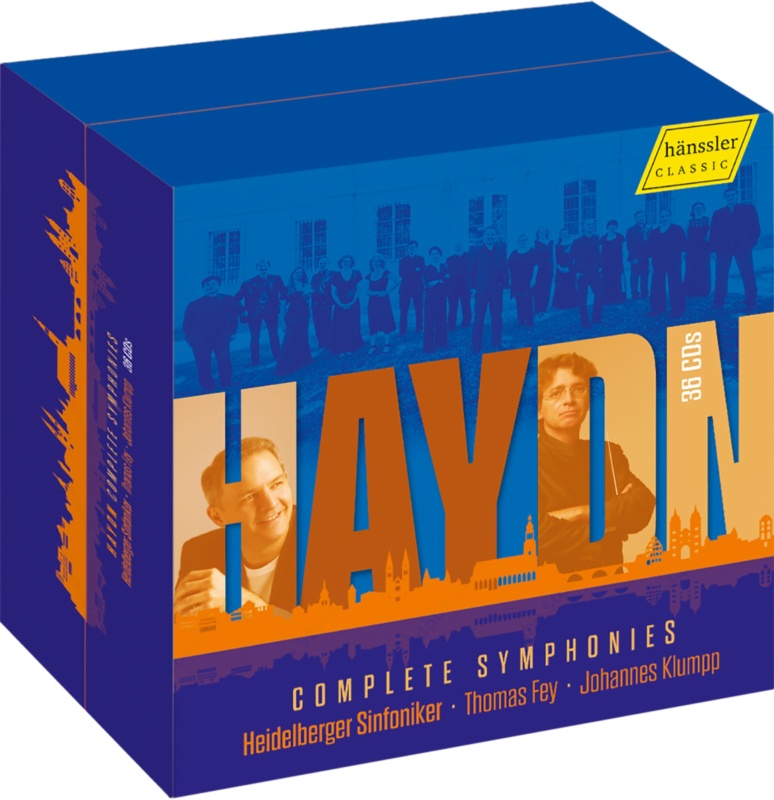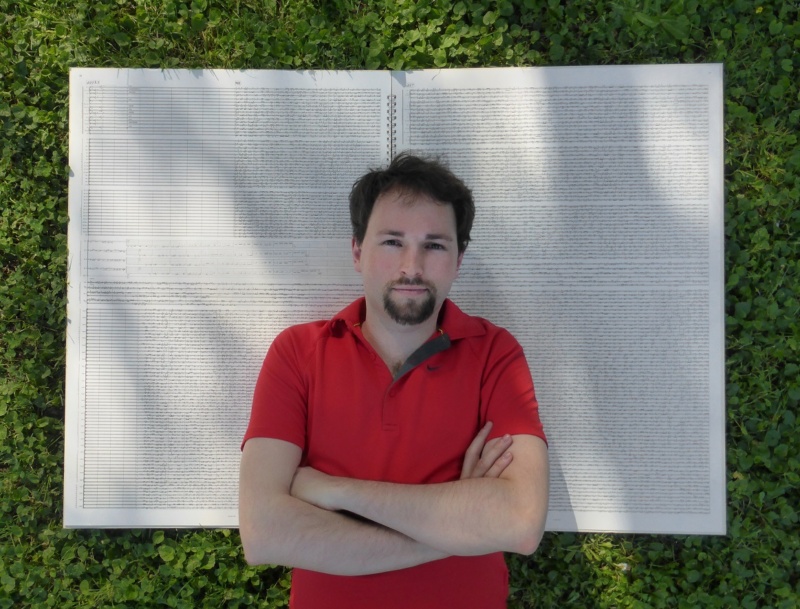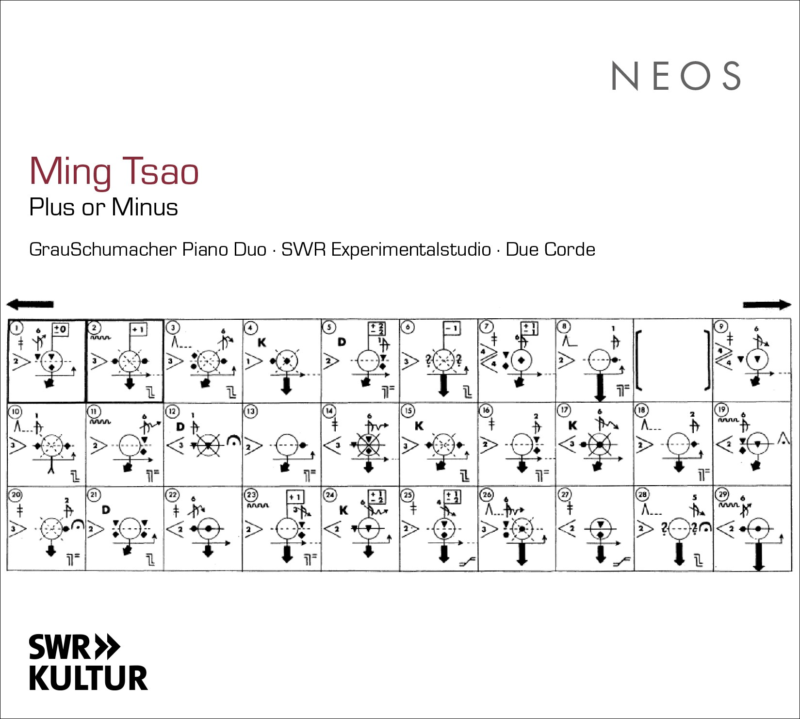Für Olli Mustonen folgte 2019 auf ein ereignisreiches Jahresende ein nicht minder spannender Start in die neue Dekade. Dass er im November mit dem Paul Hindemith Preis der Stadt Hanau ausgezeichnet wurde, ehrt den 1967 in Finnland geborenen Pianisten, Dirigenten und Komponisten besonders – beruft er sich doch schon nahezu sein gesamtes künstlerisches Leben lang auf Hindemith als eine Art Idealfigur des alle vorgefertigten Rollen transzendierenden Universalmusikers.
Über dieses Vorbild sprach Olli Mustonen Ende 2019 im Interview ebenso wie über ein frühes musikalisches Schlüsselerlebnis und über zwei aktuelle Kompositionen: Die höchst erfolgreich gemeinsam mit seinen Wegbegleitern Steven Isserlis und Ian Bostridge uraufgeführte „Sinfonie für Tenor, Cello und Piano“ mit dem Titel Taivaanvalot sowie das Sextett, das 2020 die BTHVN WOCHE Bonn im 250. Geburtsjahr des Komponisten beschloss.
Olli Mustonen, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Paul-Hindemith-Preis. Was bedeutet Paul Hindemith für Sie persönlich?
Schon immer ist Hindemith eine bedeutende Figur für mich, einer meiner Helden. Er war eine derart vielseitige Persönlichkeit: Er startete als Geiger und Bratscher, und wir kennen ihn natürlich als einen der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Ein wunderbarer Dirigent war er außerdem. Und auch ein professioneller Karikaturist hätte aus ihm werden können, sieht man sich zum Beispiel seine Illustrationen zu seinem wichtigsten Klavierwerk, Ludus Tonalis, an. Die Zeichnungen von Löwen und Schlangen und allerlei absonderlichen Dingen sind nicht nur lustig und atmosphärisch für das Werk, sondern sie helfen sogar bei der Analyse der Fugen. Er schrieb auch wunderbar über Musik und Philosophie, organisierte als junger Mann Festivals mit zeitgenössischer Musik und setzte sich für musikalische Bildung ein. Wenn ich selbst in Interviews über meine Dreifachrolle als Pianist, Komponist und Dirigent befragt werde, zitiere ich ihn gern mit dem Ausspruch: Ich bin ein Musiker, der Viola spielt, ein Musiker, der dirigiert und ein Musiker, der komponiert. Dieses Allround-Verständnis entspricht der Vorstellung vergangener Zeiten, als die Rollen noch nicht so sehr in Komponist und Interpret aufgesplittet waren. Ich fühle mich dieser Idee sehr nahe und denke, dass es Probleme verursachen kann, wenn Komponisten und Interpreten sich zu sehr voneinander entfernen. Die Interaktion zwischen beiden ist wirklich essentiell für die Musik. Ich selbst hatte das große Glück, als Dirigent und Pianist mit fantastischen Komponisten wie Rodrian Schtschedrin, meinem Lehrer Einojuhani Rautavaara oder John Adams arbeiten zu können – und als Komponist für wunderbare Kollegen Musik zu schreiben. Paul Hindemiths Musik erscheint mir zeitlos, während andere musikalische Moden kommen und gehen. Ich höre in seiner Musik außerdem gewissermaßen die gesamte Musikgeschichte – und vielleicht auch, wie bei Bach, die Zukunft der Musik. Er war ja sehr an Alter Musik interessiert, als das noch gar nicht en vogue war – alle Musik von vor seiner Zeit war ihm wichtig.
Alte Musik spielte auch für Ihre musikalischen Anfänge eine große Rolle – Sie sind die einzige mir bekannte Person, deren erstes Instrument das Cembalo war. Was haben Sie für Erinnerungen an diese frühe Zeit?
Meine Eltern interessierten sich sehr für Alte Musik; Anfang der 70er Jahre war das noch recht ungewöhnlich. Sie kauften also ein Cembalo, auf dem meine Schwester spielte, und ein kleines Spinett, das mein erstes Instrument wurde. So wuchs ich mit der Musik von Bach und Scarlatti und Byrd und den Virginalisten auf, auch Frescobaldi, Couperin, Rameau. Als ich sieben war, beschlossen meine Eltern, dass eine Cembalistin in der Familie reicht, und sie kauften mir ein Klavier. Ich erinnere mich an einen wichtigen Moment, als ich lernte, Noten zu lesen. Mein Vater ist Mathematiker und, wie viele seiner Kollegen, sehr an Musik interessiert; er spielt Geige. Mit meiner Schwester spielte er irgendeine Barocksonate, und ich beobachtete die Noten hinter ihrem Ellbogen. Ich weiß noch, wie ich dachte: Ich kann die schwarzen Punkte auf dem Papier erkennen, aber ich werde nie ihre Bedeutung verstehen. Kurz darauf, in einer meiner ersten Cembalostunden, lernte ich ganz plötzlich das Notenlesen. Natürlich war mir vorher erklärt worden: OK, dieser schwarze Punkt zwischen diesen beiden Linien entspricht dieser Taste, dann drückst Du sie und – Pling! – ein Klang ertönt. Aber all dies blieb sehr theoretisch, aufgeteilt in diese drei Ebenen von Note, Fingerbewegung und Klang. Aber in jenem Moment wurde daraus plötzlich ein dreidimensionales Bild. Man würde denken, dass dies nach und nach passiert, aber ich erinnere mich, dass ich aus dem Zimmer kam und meinen Eltern und meiner Schwester mitteilte, ich könne nun Noten lesen. Am gleichen Abend spielte ich alles, was mir vorgelegt wurde: Das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, die Kleinen Präludien und Fughetten von Bach. Es war, als hätte man mir den Schlüssel zur Schatztruhe der klassischen Musik überreicht. Es mag seltsam klingen, aber ich habe seitdem eigentlich nichts Wesentliches über das Notenlesen hinzugelernt.
Das ist eine faszinierende Geschichte – sie klingt fast wie eine magische Initiation.
Es war wie ein direkter Pfad zu einer sehr wichtigen Wahrheit. Das Notationssystem der europäischen klassischen Musik ist genial. Immer gab es, auch in anderen Kulturen, herausragend talentierte Musiker, die ihr Können von Generation zu Generation weitergaben. Aber erst die Notation befähigte uns, den musikalischen Prozess sozusagen auf dem Papier einzufrieren. Und dadurch konnte sich das musikalische Wissen aus Jahrhunderten anhäufen und ließ sich Musik auf beispiellose Weise analysieren. Unser Notationssystem ist sehr präzise, aber gleichzeitig muss man zwischen den Zeilen lesen können. Interessant ist auch, dass es nahezu unverändert der Musik von Bach, Brahms, Schostakowitsch, Schönberg gedient hat, obwohl diese Komponisten doch offensichtlich sehr unterschiedlich sind.
In dieser Geschichte scheint sich für mich auch zu spiegeln, was oft für Ihr Spiel als typisch beschrieben wird: Die Synthese zwischen der rationalen und intuitiven Seite in Ihren Interpretationen.
Oft wird angenommen, dass analytisches Denken und intuitive Prozesse Gegenspieler sind und einander ausschließen. Aber ich denke, das Gegenteil ist der Fall: Alle große Musik ist eine Art Dialog und Synthese zwischen beidem. Daraus ergibt sich für mich, dass ich oft das Gefühl habe, keine Wahl zu haben: dass es nur eine Art gibt, wie ich gemäß meiner inneren Stimme ehrlich spielen kann. Auch, wenn ich als Zuhörer im Konzertsaal sitze, gibt es in besonderen Momenten dieses Gefühl, es könne nur so und nicht anders sein. Das ist gewissermaßen die Definition für ein überzeugendes Spiel. Ich erinnere mich an mehrere unglaubliche Solokonzerte von Emil Gilels, der früher häufig in Finnland gastierte. Er nahm die Zuhörer mit auf eine Reise, das Klavier wurde zum fliegenden Teppich. Es gibt ja auch Konzerte, bei denen man zwei Stunden auf seinem Stuhl sitzt, ohne dass etwas Besonderes passiert, obwohl exzellent gespielt wird. Aber bei Emil Gilels fühlte man sich nie, als hätte man zwei Stunden dagesessen, sondern es fühlte sich an wie ein Trip in eine andere Welt, von dem man als eine andere Person zurückkehrt.
Vielleicht passt es gut zu diesem Gedanken, wenn wir nun ein wenig über Ihr neues Werk Taivaanvalot sprechen, das das Publikum ebenso in eine andere Welt entführt. Glückwunsch übrigens auch dazu – Sie haben in letzter Zeit mit Tenor Ian Bostridge und Steven Isserlis am Cello drei sehr erfolgreiche Aufführungen absolviert.
Taivanvaalot hat viel mit dem finnischen Nationalepos, der Kalevala, zu tun. Sie basiert auf der mündlichen Tradition der finnischen Mythologie, die uns von Runensängern, also einer Art Barden, überliefert wurde. Sie sangen diese alten Verse vor allem in Karelien noch bis vor ungefähr 150 Jahren. Und in der Tat hat das Stück für mich auch mit dem zu tun, worüber wir gerade sprachen, mit Gilels und den magischen Momenten. Denn auch die Barden nahmen die Zuhörer mit in andere Welten, das Reich der Sagas und der Poesie. Meine Komposition nutzt die englische Übersetzung von Keith Bosley; dabei ist vieles im Original nicht recht übersetzbar – ein komisches Unterfangen also für einen Finnen, ein auf der Kalevala beruhendes Werk auf Englisch zu komponieren. Aber solange immer noch so viele Menschen weltweit des Finnischen nicht mächtig sind, dachte ich mir, es sei keine schlechte Idee. Die Musik kann die nicht übersetzbaren schamanistischen und hypnotischen Elemente wieder hinzufügen. Und wenn am Ende nach 27 Minuten englischem Text Ian Bostridge auf Finnisch singt und als die Hauptfigur der Kalevala, Väinämöinen, die Sonne und den Mond beschwört, ist das ein sehr ergreifender Moment.
Ein weiteres Werk, Ihr neues Sextett für Streichquartett, Viola und Kontrabass, kommt als Auftragswerk zum Abschluss der Beethoven-Woche im Beethoven-Jubiläumsjahr zur Uraufführung. Es ist der einzige Festivalbeitrag, der nicht aus der Feder Beethovens stammt.
Richtig. Und wenn man so einen Auftrag erhält, möchte man ganz sicher nicht sein dämlichstes Stück abliefern. Ich habe also viel darüber nachgedacht, was für ein Werk das werden soll. Natürlich wünschten sich die Auftraggeber, dass es etwas mit Beethoven zu tun hat. Beethoven – Entschuldigung, wenn das keine große Überraschung ist – war immer einer der wichtigsten Komponisten in meinem musikalischen Leben, neben Hindemith, Bach, Brahms, Prokofjew und Sibelius. In einigen meiner Kompositionen kann man sogar Anklänge an Beethoven bemerken, auch stilistisch ist seine Welt mir sehr nah. Ich habe ihn in zwei meiner Werke in kleinen Ausschnitten zitiert. Allerdings ist es oft für Komponisten wichtig, sich selbst ein paar Limits aufzuerlegen, und mir erschien es in diesem Fall irgendwie zu einfach, Beethoven zu zitieren. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, und es fühlte sich nicht richtig an, bis ich mir schließlich sagte: Ich fange mit etwas ganz anderem an und warte ab, ob Beethoven nicht irgendwann in die Musik hineinkommt.
Eine Séance mit Beethoven also?
Das könnte man sagen. Das Werk beginnt mit zwei sehr dissonanten Akkorden und einem großen Chaos. Fast ist es, als fände sich der Zuhörer auf einem feindlichen Planeten ohne jegliches Leben wieder. Nach einer Weile regen sich lebendigere Figuren und fangen nach und nach an, in Richtung Beethoven zu weisen. Mit dem letzten Satz ist es eine merkwürdige Sache: Als Pianist habe ich viele Variations-Werke gespielt, natürlich vor allem von Beethoven, da es so viele von ihm gibt. Aber ich selbst hatte nie Variationen komponiert, bis ich für diesen Satz eine Cavatina mit Variationen schrieb. Eine zweite Sache, die es in meinen Kompositionen zuvor nicht gab, war irgendeine Nähe zum Rezitativ – auch dies eine Geste, die man beim späten Beethoven häufig findet, zum Beispiel in der Sturmsonate und natürlich in der 9. Sinfonie. Nun wurde daraus ein weiteres Element, das mein Stück mit Beethoven verbindet. Es ist wie eine Reise weg von dem feindlichen Planeten und hin zu Beethoven.
Nina Rohlfs, 12/2019