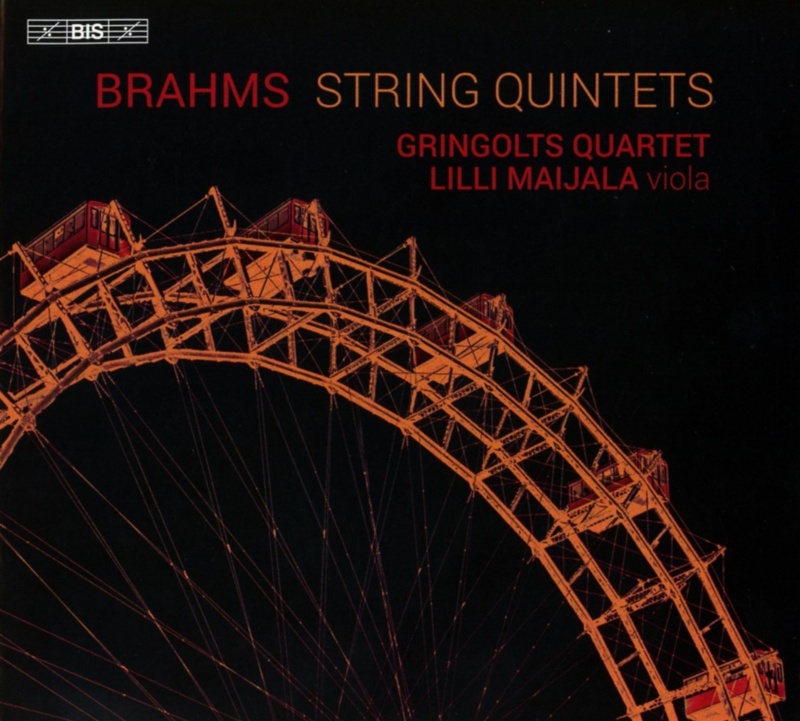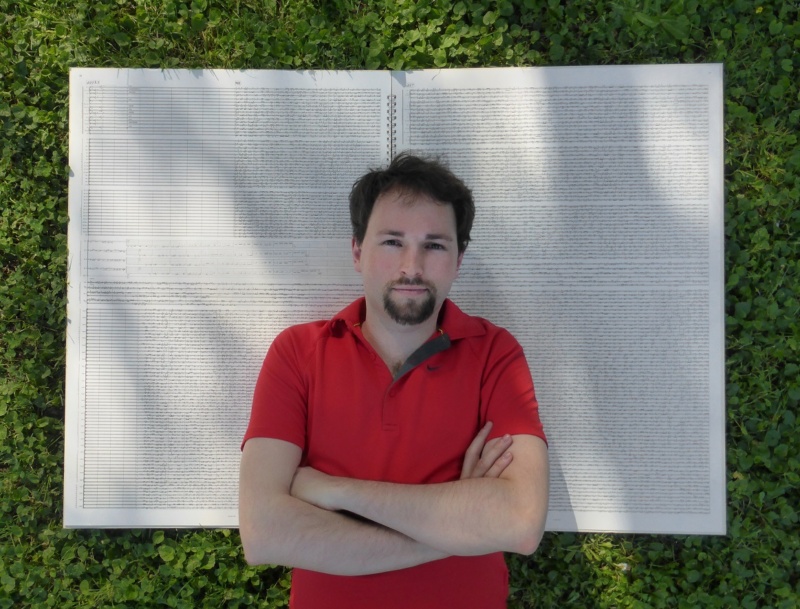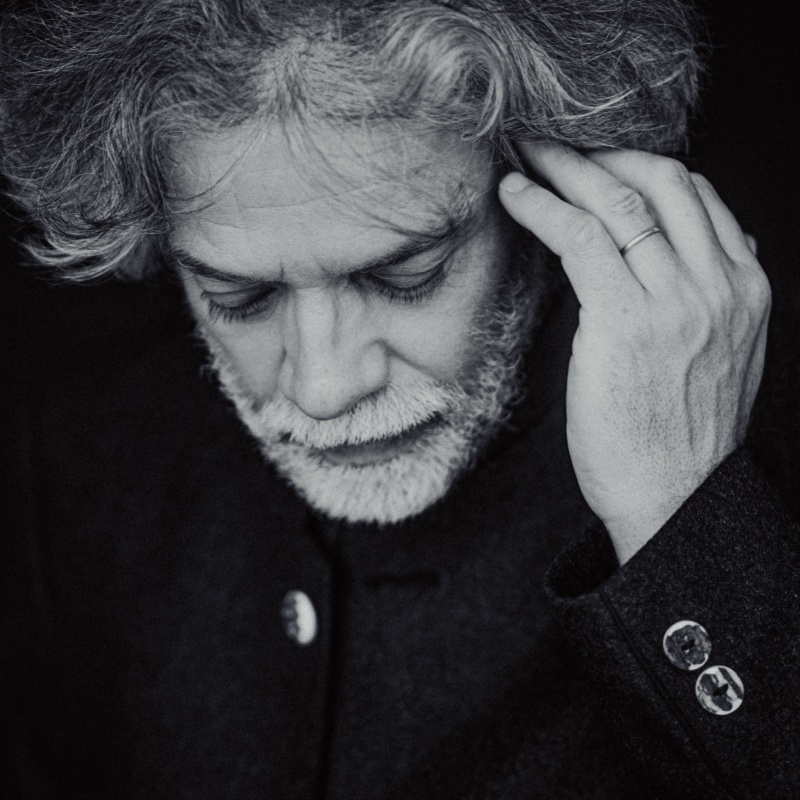Kurz nach dem Gespräch feierte die Geigerin ihren Geburtstag mit einem besonderen Konzert in Berlin: Das Kammerorchester Camerata Bern, das ab 2009 für fast zehn Jahre unter ihrer Leitung stand, war dafür am Konzerthaus zu Gast.
Sie feiern in diesem Jahr Ihren 50. Geburtstag. Ist das für Sie ein Meilenstein?
Nein, ehrlich gesagt mache ich mir nicht viel aus Zahlen, so lange es mir gut geht. Manchmal kann ich nicht glauben, dass es schon die 50 sein soll. Aber irgendwie ist es doch ein Geburtstag wie jeder andere.
Nutzen Sie den Anlass, um über Ihre Karriere nachzudenken?
Eigentlich nicht. Meine Karriere verlief immer recht flexibel und nie ganz gradlinig in eine Richtung. Gelegenheiten haben sich einfach ergeben, zum Beispiel vor vielen Jahren das Arcanto Quartett, und dann die Camerata Bern – ich habe nie geplant, ein Kammerorchester zu leiten, das ist einfach passiert! Allerdings brauche ich diese verschiedenen Aktivitäten – Solokonzerte, Rezitale, Kammermusik in allen möglichen Besetzungen. Ich freue mich immer auf die Dinge, die auf mich zukommen.
Haben Sie noch Gemeinsamkeiten mit der jungen Geigerin, die Sie zu Beginn ihrer Karriere waren?
Heute weiß ich, was mir beim Musizieren wichtig ist. Das war ganz anders, als ich jung war. Ich brauchte einige Jahre – inklusive einiger Krisen – um es herauszufinden. Das Unterrichten hat mir dabei sehr geholfen. Am Anfang war ich eine Instinktmusikerin, aber als ich mit dem Unterrichten anfing, musste ich mehr Klarheit in meine Gedanken bringen, um meine Ideen erklären zu können. Man kann nicht einfach sagen „das ist halt mein Gefühl“, sondern muss wirklich beweisen, dass man sorgfältig mit der Partitur und mit der spezifischen Sprache eines Komponisten umgeht.
War das Geigenspiel immer eine Möglichkeit für Sie, sich auszudrücken?
Absolut. Ich würde sagen, das ist meine eigentliche Stimme. Ich kann viel besser spielen als reden (lacht). Ich versuche immer, mit den Menschen auf der Bühne zu kommunizieren und auch mit dem Publikum im Saal. Man kann nicht ganz erklären, was in diesen Augenblicken passiert, aber man spürt die Spannung, und dadurch entsteht eine ganz besondere Situation, die man nur in einem Livekonzert erlebt.
Erklärt dieser Wunsch nach Kommunikation auch, dass Sie so viel Kammermusik machen?
Man hört oft, dass Kammermusik kommunikativer sei und dass es beim Solospiel mit Orchester anders ist. Aber für mich gibt es da keinen Unterschied. Wenn man mit einem Orchester und einem Dirigenten spielt, und es findet keine Kommunikation statt – wer will das denn hören? Ich möchte immer kommunizieren, auch mit großen Ensembles.
Im Konzerthaus treten Sie mit der Camerata Bern auf. Was sind die Herausforderungen beim Leiten eines Orchesters im Vergleich beispielsweise zu einem Streichquartett?
Das ist eine ganz andere Probenarbeit und Vorbereitung. Man braucht ein sehr klares Konzept dessen, was man aus dem Stück machen möchte, und gleichzeitig die Freiheit, darauf zu reagieren, was die anderen beitragen. Dazu kommt die Energie auf der Bühne: eine Art Wunder, das ich immer noch nicht erklären kann. Wir proben zusammen, jeder weiß, was wir erreichen möchten, und dann passieren doch eine Million andere Dinge auf der Bühne. Das ist in dem Moment gleichzeitig sehr herausfordernd und sehr beglückend.
Hatten Sie, als Sie die Leitung der Camerata übernahmen, eine Vorstellung, welche Art von Musik Sie spielen wollten?
Wir fingen mit dem normalen Repertoire an, dann mit Transkriptionen für Streichorchester. Von Jahr zu Jahr wurden wir kühner. Beethovens 1. und 8. Sinfonie funktionieren, weil sie sehr klassisch sind, aber wir haben auch Beethovens Violinkonzert ohne Dirigenten ausprobiert, und es hat geklappt. Manches geht mit Dirigat besser, manches schlechter. Aber diese direkte Kommunikation, dieses gemeinsame Tun im Moment – das ist sehr schwer zu erreichen, wenn ein Dirigent im Spiel ist.
Im Konzerthaus bringen Sie Beethovens Kreutzersonate zur Aufführung, arrangiert für Orchester.
Man sollte allerdings nicht das gleiche Stück erwarten! Zwar ist jede Note da, die Beethoven geschrieben hat – nichts wurde hinzugefügt oder weggenommen. Trotzdem ist es eine völlig andere Klangwelt als die Sonate für Geige und Klavier. Der zweite Satz wird zu einer Art Streichsextett. Der letzte Satz ist schwierig, aber er behält diese absolute Energie, dieses Prestogefühl. Wir wollen das Stück nicht verbessern, sondern eine andere Herangehensweise anbieten, durch die man das Stück auf neue Art hören kann.
Was zieht Sie an einem Stück an? Gibt es einen roten Faden in Ihrem Repertoire?
Ich versuche immer, etwas Neues zu finden. Ich finde es merkwürdig, wenn man sich in nur einem Stil spezialisiert. Mir wäre das zu langweilig. Deshalb möchte ich die ganze Bandbreite des Repertoires spielen, alles von Bach bis zur zeitgenössischen Musik, und dabei jedes Stück in dem Stil interpretieren, in dem es komponiert ist. Interessant und wichtig finde ich, dass jeder Komponist eine völlig eigene Sprache hat und deshalb einen anderen Klang, eine andere Phrasierung, eine andere Artikulation erfordert.
Haben Sie immer noch Lampenfieber?
Natürlich. Ich habe gelernt, damit umzugehen, aber ohne diese Spannung kann ich nicht auf die Bühne gehen. Wenn sie positiv ist, dann ist sie eine Energie. Es ist ein natürlicher Bestandteil des Auftretens, vorher aufgeregt zu sein. Sobald ich feststellen sollte, dass es sich nur noch nach Routine anfühlt, werde ich damit aufhören! Deshalb spiele ich auch nicht das gleiche Stück zwanzig Mal. Jede Woche mache ich etwas anderes, dadurch bleibt meine Herangehensweise frisch. Ich hoffe, dass ich noch so lange wie möglich spielen werde!
Sam Johnstone, 11/2016 | Übersetzung: Nina Rohlfs