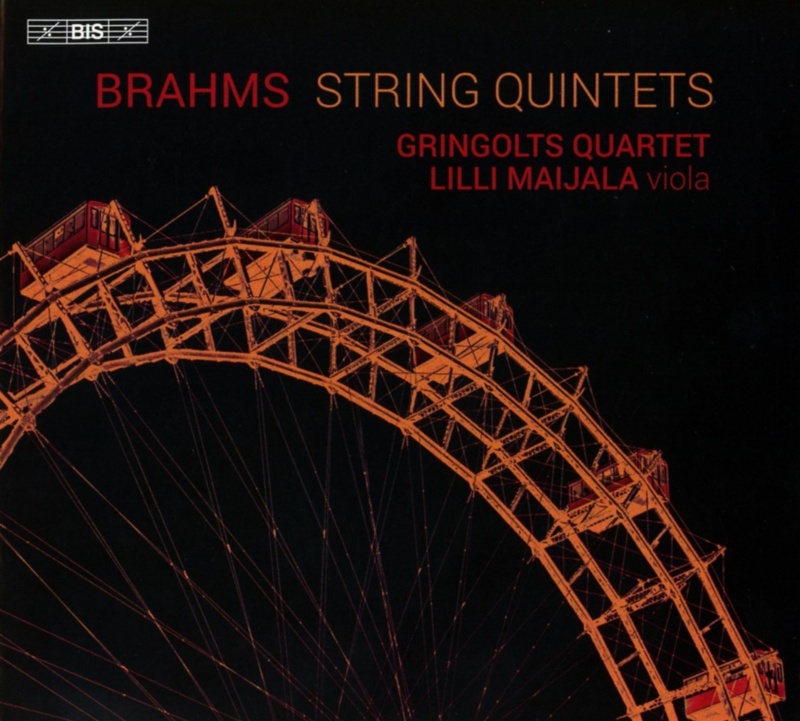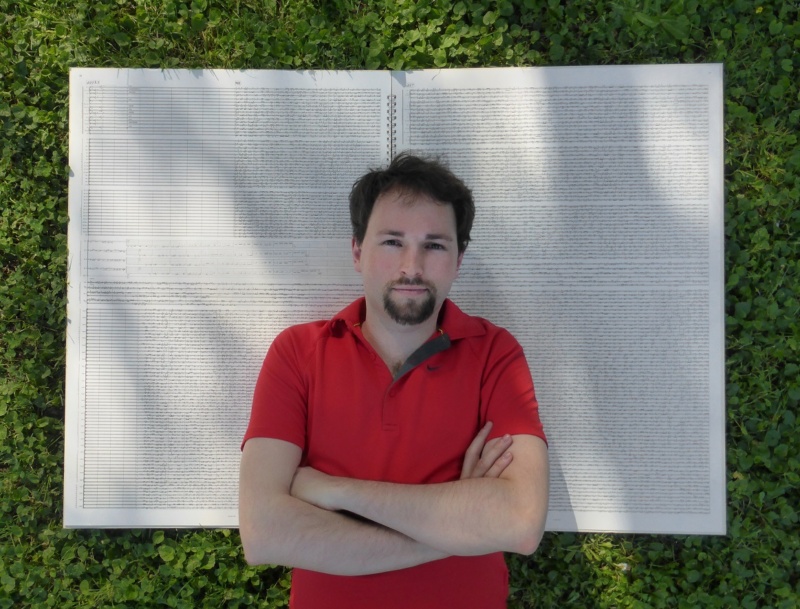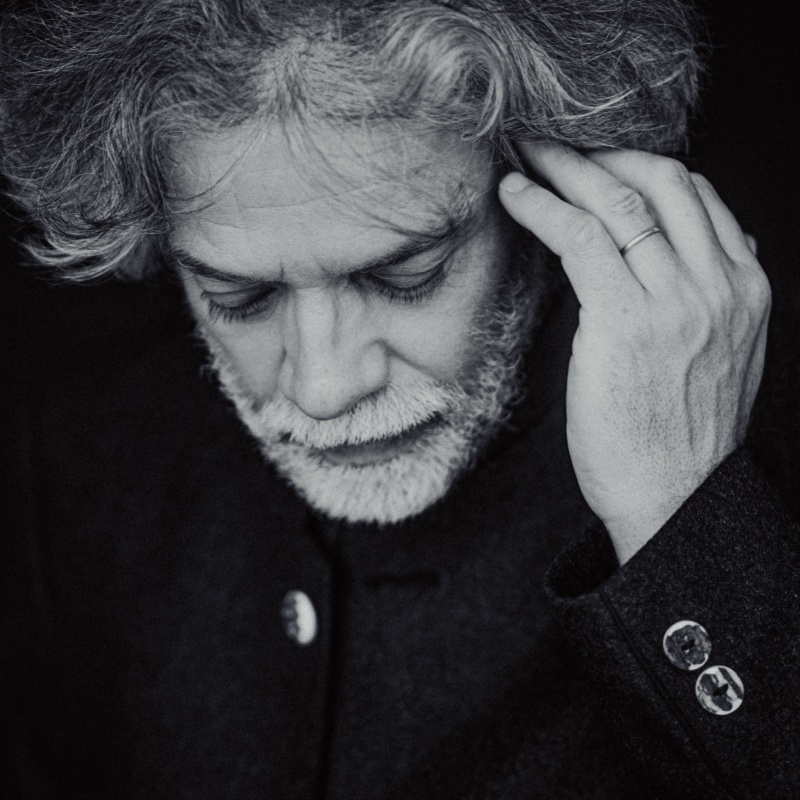An sechs Terminen zeigte die Ruhrtriennale 2017 Philippe Manourys Musiktheaterwerk Kein Licht, ehe es in Straßburg und am Kroatischen Nationaltheater in Zagreb sowie am Grand Théâtre de Luxembourg zu erleben war. Im Vorfeld der Uraufführung sprach die Musikjournalistin Hannah Schmidt mit dem Komponisten über die Produktion, die sie auch in anderen Beiträgen journalistisch begleitet hat – ihr umfangreiches und äußerst lesenswertes Dossier zu Kein Licht mit Interviews, Hintergrundberichten und einer Fotostrecke ist auf der Website terzwerk.de zugänglich. Wir veröffentlichen den Artikel zu ihrem Gespräch mit Philippe Manoury mit freundlicher Genehmigung der Autorin.
Als er Elfriede Jelineks Text zum ersten Mal las, reagierte Philippe Manoury mit einem Stirnrunzeln, überrascht über diesen „obskuren Text“, wie er selbst sagt. Der für ihn ins Französische übersetzte Text wirkte auf ihn kompliziert und schleierhaft, „und zuerst dachte ich, es ist schier unmöglich, diesem Text, in dem nur geredet, geredet, geredet, eigentlich monologisiert wird, eine dramatische Struktur zu geben.“ Erst im zweiten Anlauf gelang es ihm, erste Ideen für seine Komposition zu entwickeln – und die ist weit von dem entfernt, was Manoury bis dato musikalisch geschaffen hat.
Das Licht in dem unterirdischen Aufnahmeraum des IRCAM ist grell, die Wände sind grau und schalldicht, jeder Laut scheint im Moment seiner Entstehung direkt wieder geschluckt zu werden. Alles wirkt technisch und steril, weltfern wie in einem U-Boot oder Raumschiff. An diesem schalltoten Ort entstehen große Teile von Philippe Manourys Musik zu „Kein Licht.“
Ende Juli, als er sich zum Interview an den in der Mitte stehenden Tisch voller Mischpulte setzt, ist der Großteil seiner musikalischen Arbeit für die Oper fertig gestellt, aber eben nur der Großteil: Die Proben laufen schon seit drei Wochen, nur wenige Metrostationen entfernt, auf einer kleinen, dunklen Probebühne im sechsten Stock der Opéra Comique. Philippe Manoury lehnt sich entspannt in seinem Bürostuhl zurück und faltet die Hände. „Ich glaube, die Oper braucht eine Erneuerung“, sagt er. „Keine Revolution, aber eine Erneuerung. Wir können nicht so weitermachen wie bisher, wir können nicht weiter komponieren und singen wie noch im 17., 18. und 19. Jahrhundert.“ Das Publikum habe sich verändert, die Art der Menschen zu rezipieren habe sich verändert, „und wir müssen uns da anpassen“.
„Kein Licht.“ ist also sein Vorschlag für eine Form der Oper, die er als „völlig neu“ bezeichnet – er, Philippe Manoury, ein Forscher und Wegbereiter, ein Pionier gar der elektronischen Musik und nach Pierre Boulez das Aushängeschild der französischen Avantgarde. Der Faktor, um den für ihn in dieser seiner fünften Oper alles kreist, ist die Zeit. „Ich glaube, es ist wichtig, den Umgang mit der Zeit im Theater mit dem in der Musik zu mischen“, sagt er. „In der Musik ist Zeit sehr strukturiert, sie hat eine bestimmte Länge und ein bestimmtes Tempo, das man nicht ändern kann, diese Zeit ist abgeschlossen. Im Theater dagegen wird frei mit Zeit umgegangen, sie fließt, die Schauspieler können das, was sie sagen, anpassen und verändern, mal warten, mal schneller sprechen.“
Als Komponist einer Oper, sagt Manoury, agiere man daher wie ein Szenograph, man nehme dem Regisseur die Freiheit, auf Proportion, Dauer, Tempo und Ausdruck einzugehen, denn dieser müsse sich der Zeit der Musik unterwerfen. Also komponiert Manoury mit „Kein Licht.“ keine fertige Oper von Anfang bis Ende, sondern voneinander unabhängige Abschnitte, die er „Module“ nennt. Diese Module sind in sich zwar durchkomponiert, aber die Reihenfolge, in der sie am Ende stehen werden, ist nicht vorgegeben. Gleichzeitig wird während der Proben, bei denen Manoury in der Regel anwesend ist, auch in die Komposition und in bereits ausgedachte Strukturen eingegriffen. Diese Eingriffe reichen von kleinen Anpassungen beispielsweise in Bezug auf die Länge einer Fermate oder Pause bis hin zu der vollständigen Umplatzierung eines gesprochenen Textteils, wenn er an einer bestimmten Stelle nicht so zur Geltung kommt, wie Regisseur Nicolas Stemann es wichtig wäre.
„Ich habe in drei Monaten den Großteil der Oper komponiert, und jetzt ist es Nicolas Stemanns Aufgabe, den Text in den Modulen und dazwischen unterzubringen“, sagt Manoury. „Es gibt Stellen, da wird unterschiedlicher Text gleichzeitig gesprochen und gesungen. Das ist natürlich eine Herausforderung für den Hörer, der sich entscheiden muss, ob er dem einen Text folgt oder dem anderen oder gar beiden abwechselnd.“ Genau das sei aber ein Teil des Projektes, das Musik und Theater, Gesungenes und Gesprochenes verbinden will, nämlich die Aufmerksamkeit in Bezug auf diese beiden Richtungen zu teilen, in Bezug auf Expression und Inhalt. Ein Wort werde rational unverständlicher je mehr es gesungen werde und dabei aber gleichzeitig stärker emotional wahrnehmbar, sagt Manoury. „Ein Wort kann aber nie in gleichem Maße emotional und rational wahrnehmbar sein. Und in diesem Projekt haben wir beides, gesprochene und gesungene Sprache, womit wir versuchen, das Wort in gewisser Form zu befreien, auf beide Weisen wahrnehmbar zu machen.“
Manoury geht in seiner Komposition sogar noch einen Schritt weiter: Die vier Solisten, die er besetzt – Sopran, Mezzosopran, Kontraalt und Bariton –, sind nicht die einzigen, die in gewisser Form Sprache „singen“: Über elektronische Verzerrungen und akustische Umrechnungen wird auch die von den Schauspielern Caroline Peters und Niels Bormann gesprochene Sprache an manchen Stellen zu etwas, das klingt wie Gesang, was wird zu einer Art Rezitativ. „In Wirklichkeit“, sagt Manoury, „ist Sprechen sowieso einfach nur eine chaotische Form des Singens. Wenn man die Sprechstimme eines Menschen aufnimmt und sie 50 Mal langsamer wieder abspielt, hört man eine Melodie, eine Art Gesang. In der Realität ist das Sprechen aber so schnell, dass wir nur Chaos hören und keine klare Melodie mehr.“ In seiner Komposition versucht Manoury also diese Musikalität der gesprochenen Sprache zu extrahieren – über die Vertonung des Textes für Singstimme und über die technische Reduktion des Gesprochenen in Melodie, und also Musik und Sprache in gewisser Form (wieder) zu vereinen.
Elfriede Jelineks nicht-lineare textliche Vorlage eignet sich für diese Art der offenen Arbeitsweise und auch der Musikalisierung von Sprache oder Versprachlichung von Musik aus Manourys Sicht besonders gut: „Sie hat eine Art, musikalisch zu schreiben“, sagt er. „Beim Komponieren, beim Vertonen des Textes habe ich Stellen entdeckt, die wie in einem Gedicht bestimmte wiederkehrende rhythmische Motive und Ideen verarbeiten, die manchmal kontrapunktisch einander gegenüber stehen. Man merkt, dass Elfriede Jelinek einen musikalischen Hintergrund hat.“ Diese musikalischen Motive im Text verarbeitet Manoury in seiner Musik wie auch inhaltliche Motive und Leitideen, „Wind oder Tränen beispielsweise“, über eine Art musikalischer Leit-Strukturen: „Der Wind ist bei mir beispielsweise immer die schnelle Abfolge von wiederholtem Geräusch oder die Nachahmung von so etwas wie Wind-Geräuschen, etwas sehr schnelles, flexibles“. Auch drei Trauergesänge, drei Lamenti, hat er geschrieben, die die „Trauernde Frau“ aus Jelineks Text singt, „alle drei in einer anderen Art musikalischer Struktur, sehr langsam, viele aufsteigende und absteigende Linien, sehr klagend.“
Eine Jelinek’sche Leitidee, die Manoury plakativ vertont, ist das Tier als menschliche Bezugsgröße: Der „Trauernden Frau“ ist durch die Katastrophe in Fukushima alles genommen worden, Mann, Kinder, Haus, Auto, und das einzige, was ihr geblieben ist, sind ihre Hunde, für die sie sich schick macht, für die sie weiterlebt. Manoury schreibt dafür jedoch keine jaulenden Melodielinien oder kläffenden Sprechgesang in die Stimmen, sondern er setzt kurzerhand einen echten Hund auf die Bühne. Cheeky, dressiert, kann auf Kommando ihrer Trainerin bellen und jaulen. In einem Solo und später in einem Quartett mit den drei Frauenstimmen soll Cheeky auf der Bühne eine Darstellerin wie alle anderen sein. „Sie wird die Oper sogar eröffnen“, sagt Manoury. Das sei schon entschieden. „Der Vorhang öffnet sich. Und dann sitzt da der Hund, schaut die Zuschauer an und singt seine Arie.“ Nur begleitet durch eine Solo-Trompete.
Dieses Projekt übertrifft musikalisch wohl alles, was bisher auf Opernbühnen geschehen ist. Philippe Manoury reizt wohl das Äußerte dessen aus, was Opernmusik kann und vermag, und vielleicht gar das, was Opernmusik aushält. „Ich würde mich freuen, wenn die Effekte am Ende so sind, dass manche Zuhörer im Publikum nicht mehr ausmachen können, ob gerade gesprochen oder gesungen wird“, sagt Manoury. Nicht nur in der Probe werden Theater und Oper fusioniert, wird an der Zeitlichkeit und Strenge der Musik gerüttelt und gezerrt, sondern auch im Endprodukt auf der Bühne sollen diese Grenzen verschwimmen. Aus dem „Singspiel“ wird ein „Thinkspiel“, wie Manoury es nennt, ein Stück, das nicht einfach nur herunterproduziert wird, sondern in dem sich Darsteller, Sänger, Musiker, Regie und Technik hintergründig mit der Thematik auseinandersetzen. Die Musik ist bei der Vermittlung dieser Thematik nicht Vehikel, sondern aktiver gestalterischer und unabdingbarer Teil, wie auch der Text. Nein, nicht „wie“: Denn Text und Musik sind im Prinzip – eins.
Hannah Schmidt, 8/2017
Zuerst veröffentlicht unter http://www.terzwerk.de/manoury/