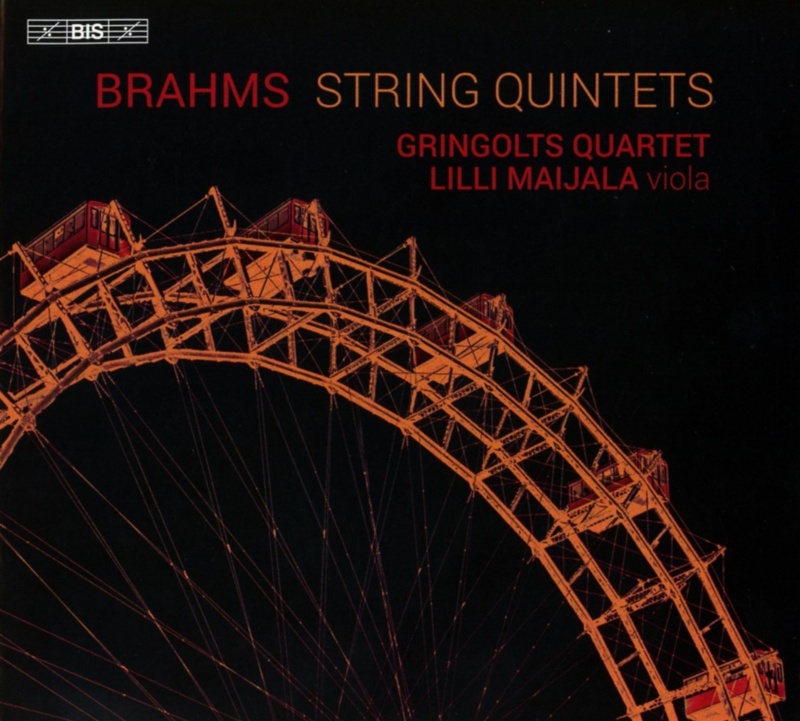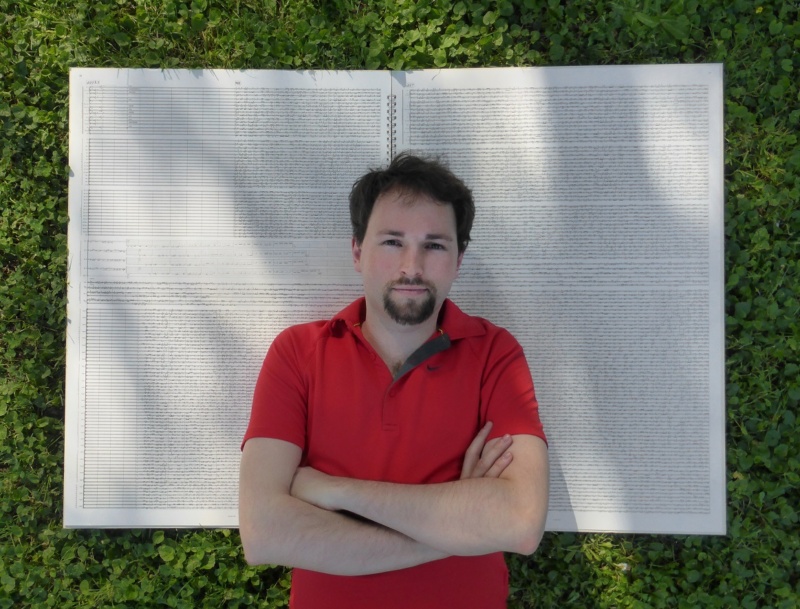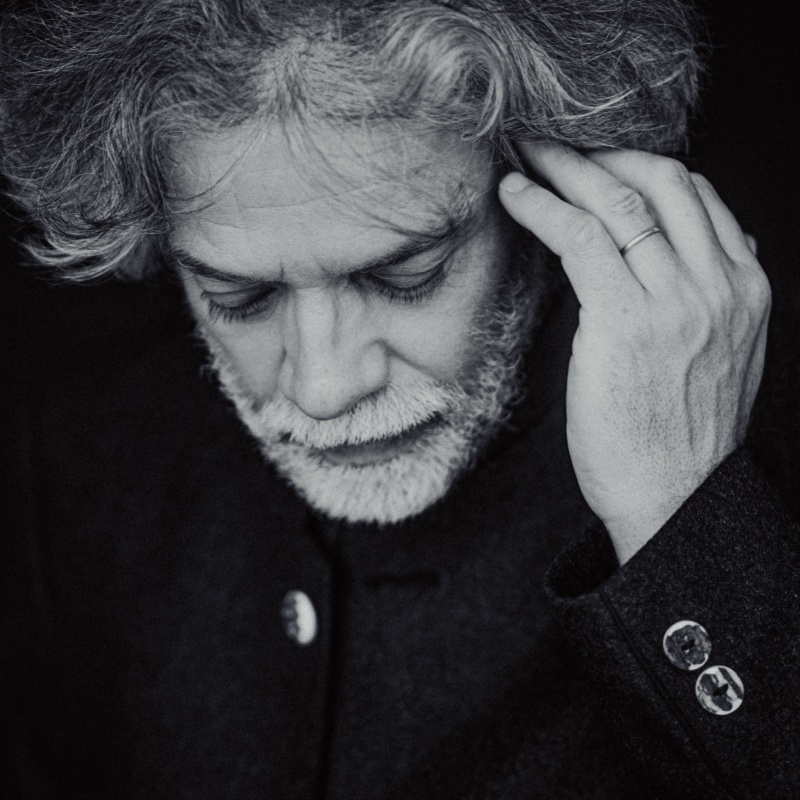Porträt aus dem Jahr 2012
Man sollte sich von dem Namen nicht irreführen lassen – Samir Odeh-Tamimi
ist ein durch und durch deutscher Komponist:
Palästinensisch-israelischer Herkunft, hat er sein gesamtes
Musikwissenschafts- und Kompositionsstudium hier absolviert, und in den
nunmehr rund fünfzehn Jahren seiner kompositorischen Tätigkeit wurden
und werden seine Werke unter anderem vom Ensemble Modern, der
musikFabrik, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem
WDR Chor aufgeführt. „Ich lebe seit über 20 Jahren hier, aber kein
Mensch kommt normalerweise auf die Idee, mich nach dem Deutschen in
meiner Musik zu fragen“, amüsiert er sich. „Naja, ich würde auch eher
davon sprechen, was das Westliche in meiner Musik ist. Die Neue Musik
ist ja nicht deutsch, sie ist eine westliche Bewegung, die Avantgarde,
auch in der bildenden Kunst.“
„Ich habe die westliche Kultur aufgesaugt und weiß mittlerweile viel
mehr über sie als über die Kultur, aus der ich stamme. Und die Kultur,
aus der ich stamme, bleibt doch als Erinnerung, alles, was gespeichert
wurde, bis zu einem bestimmten Alter. Aber ich beginne eigentlich erst
jetzt wieder, eine ganz starke Verbindung zur arabischen Welt
herzustellen.“
Doch ehe wir uns in eine Diskussion über korrekte nationale Einordnungen
verstricken, lasse ich mir lieber erklären, was das Ganze eigentlich
für den Schaffensprozess und die Tonsprache dieses Künstlers heißt. „Ich
kann schon behaupten, dass ich eine ganz eigene Musiksprache habe“,
sagt der Komponist, „aber die zu beschreiben, ist gar nicht so einfach.
Es hat alles angefangen mit einem Koransänger aus Ägypten, Sheikh Abdul
Basit. Übrigens habe ich da am Anfang eine ganz große Ähnlichkeit
empfunden mit der Musik von Giacinto Scelsi, und ich habe mir
eingebildet, er müsse diesen Sänger gekannt haben, denn Scelsi hat ja
einige Jahre in Kairo gelebt. Mich selbst hat dieser Koransänger schon
in der Kindheit so bewegt, dass ich ihn gesanglich imitiert habe. Und in
Bremen habe ich dann im elektronischen Studio seine Stimme mit dem
Computer analysiert. Das war verblüffend. Ich habe mir überlegt, wie es
zum Beispiel klingen würde, wenn ich das für eine Klarinette schreiben
würde. Mir ist dabei schnell klar geworden, dass ein westlicher Musiker
diese Musik niemals im Entferntesten nachahmen kann, diese ganzen
Verzierungen, die Vibrato- und Glissandotechniken, denn das ist eine
völlig andere Musikpraxis. Und dann habe ich angefangen, an winzigen
Nuancen in der arabischen Musik zu arbeiten, diese mikrotonale und auch
zeitlich mikroskopische Ebene hat mich mehr interessiert als eine ganze
Melodie, als ein Modus. Aus diesen kleinen Nuancen habe ich große Stücke
komponiert.“
Schon immer sind es die Stimmen, die Samir Odeh-Tamimi inspirieren. Als
Jugendlicher tourte er als Keyboarder und Perkussionist durch Israel mit
einem Ensemble, das die archaische Vokalmusik der Region erstmals mit
modernen Instrumenten gespielt hat. „Ich kannte diese Musik nur durch
Frauen, Mütter, Großmütter. Wir haben daraus gewissermaßen eine
Kunstmusik gemacht, indem wir das, was wir von ganz einfachen Leuten
übernommen haben, auf eine feine Art und Weise gespielt haben.“
„Allerdings muss man sagen, nur ETWAS kommt daher, nur eine Idee, aber
die Musik geht weit darüber hinaus. Und ich bin natürlich von westlicher
Musik stark beeinflusst – von Scelsi, ich rede immer wieder von ihm,
neben Iannis Xenakis. Und Luigi Nono, ich habe ihn lange vor mir
hergeschoben, aber jetzt habe ich große Lust auf seine Musik. Auch
Beethoven, er war für mich, als ich noch in Israel lebte, der Komponist
schlechthin.“
Zu diesem ETWAS, an dem sich Samir Odeh-Tamimis Musik entzünden kann,
scheint in letzter Zeit der Sufismus zu zählen. „Das Ritual an sich hat
mich interessiert“, beschreibt er diese Beziehung, die auch
biografischen Ursprungs ist: „Ich habe mit der muslimischen Tradition
heute kaum etwas zu tun, ich bin nicht gläubig, aber meine Vorfahren
waren alle Sufis. Nicht nur von der Überzeugung, auch in der Praxis.
Dazu gehört der Verzicht auf alles, auf Besitz. Mein Großvater war
Anführer einer Sufi-Gruppe und führte dort jeden Donnerstag in der Nacht
das Ritual. Er nahm mich drei oder vier Male mit, da ich gut einen ganz
langsamen Rhythmus auf der Trommel schlagen konnte, und das hat mich
stark geprägt. Sehr oft, wenn ich komponiere, sehe ich sie so vor mir
tanzen, aber ich nehme in der Regel keinen direkten Bezug. Das war
bisher nur in zwei Stücken der Fall, nämlich in dem Stück Into Istanbul, das ich für das Ensemble Modern komponiert habe, und in der großen Komposition Rituale:
Die letzten drei Minuten, wenn das ganze Orchester außer sich gerät und
der Schlagzeuger das Orchester hält, das ist vom Sufitanz übernommen.
Vielleicht auch noch kleine Teile meiner Oper Leila und Madschnun.“
„Komponieren ist für mich ein Ritual“, erläutert er die wohl wichtigere
Ebene seiner Verbundenheit zu der spirituellen Praxis seiner Vorfahren.
Wünschenswert wäre für ihn der Ritualcharakter auch für die
Aufführungssituation – sowohl von Seiten der Musiker als auch des
Publikums. „Scelsi hat das für sich geschaffen – es gibt eine CD von
ihm, seine Klaviersuite, da steht drauf: Wenn man nicht in einer guten
Verfassung ist, sollte man diese Musik nicht hören. Ich finde es
großartig, dass er das fordert.“ Ein schwierig durchzusetzender Anspruch
allerdings in unserem Kulturbetrieb, in dem Dirigenten nach der
Aufführung direkt ins nächste Flugzeug springen, Musiker in Proben
schnell eine Anfrage auf ihrem Smartphone beantworten, die Zuhörer durch
ein eng gestricktes Festivalprogramm hecheln. Doch wenigstens im
Kompositionsprozess soll der Ritualcharakter erhalten bleiben. „Ich habe
mein Leben reduziert und habe nicht das Bedürfnis, noch zu dirigieren,
noch eine Professur zu haben, noch ein Festivalleiter zu sein“, erklärt
er.
Diese Art von Konzentration, diese Öffnung für Feinheit und Intuition
hat für Samir Odeh-Tamimi eine besondere Bedeutung. „Ich bin da ganz bei
Wolfgang Rihm, der sagt, die Musik entsteht in dem Moment, sie ist
nicht nur mit Techniken, mit mathematischen Prozessen, Algorithmen
erklärbar. Meine Musik entwickelt sich in mir, während ich spazieren
gehe, während wir hier sitzen, während ich ein Bild von Van Gogh oder
Picasso sehe.“
„Bei mir geht es sehr stark über das Hören. Ich kann irgendwo sein und
mir den Horizont ansehen, und dann klingt es plötzlich, ich höre etwas.
Ich höre Musik, ich höre ein Orchesterstück. Ich erinnere mich an die
ersten Stunden mit meiner Lehrerin Younghi Pagh-Paan, wo ich sagte, ich
höre ein ganzes Musikstück, und sie sagt, das finde ich toll. Jetzt
müssen wir dieses Musikstück aufs Papier bringen.“
„Ich mache aber diese Dinge nie bewusst.“ Im Falle seiner Komposition Shira Shir nach dem epischen Lied vom erschlagenen jüdischen Volk
des polnischen Schriftstellers Jizchak Katzenelson war es der
Gesangspart, der plötzlich in seinem Kopf herumschwirrte: „Aber ich war
überfordert mit dem, was ich hörte. Erst als die Orchestrierung fertig
war, konnte ich plötzlich in drei Stunden die Baritonstimme schreiben.
Für das ganze Stück. Das habe ich nie geglaubt. Die war seit Monaten im
Kopf. Ich bin immer damit aufgewacht.“
„Und dann mein Stück für Donaueschingen, ich habe über Monate jeden Tag
kaum zwei Stunden geschlafen, weil diese drei Weiber Tag und Nacht nicht
aufgehört haben in meinem Kopf zu schreien.“ Mit Gdadrója,
2005 in Donaueschingen uraufgeführt, habe er schließlich auch einen
„riesigen Schrei“ veranstaltet. „Aber darin erschöpft sich das Werk
nicht, denn daneben ist es eben auch hohe Kunst, es ist Musik, Dynamik,
Dramaturgie.“ Und er wendet sich gegen das, was er als gängigen
Schönheitsbegriff des heutigen Musikbetriebes empfindet: „Heutzutage
herrscht ein völlig anderer Begriff von Musikästhetik als in den 60er
und 70er Jahren: Es gibt viele etablierte Komponisten, die nur noch
schön, angenehm, bloß nicht emotional vermittelt, bloß nicht zu nah
kommend komponieren. Diesen Begriff von Musik als absolute Schönheit
lehne ich total ab. Aber es ist nicht so, dass ich da Widerstand leisten
müsste, brüllen will. Ich bin intensiv. Ich fordere, dass man mir
zuhört.“
Er führt weiter aus: „Ich habe Kunst immer als eine Message verstanden,
und nicht nur eine ...“ „Massage?“ „Ja, genau. Ein Werk wie Shattíla
ist schon auch ein politisches Statement. Ich bin aber nicht politisch
engagiert, sondern, sagen wir mal, politisch bewegt. Ich sehe mich nicht
anders als Luigi Nono in dieser Hinsicht.“
Und welche Themen werden in der näheren Zukunft eine Rolle spielen? „Die
arabischen Revolutionen – diese Massen von Menschen, die auf die Straße
gehen, die haben mich musikalisch wahnsinnig bewegt. Wenn ich diese
Demonstrationen sah, hörte ich wirklich Musik.“
„Und ich werde mich sicher auch wieder mit westlichen Themen
beschäftigen“, rettet er noch unsere Anfangsthese. „So wie ich es zum
Beispiel in meinem Werk Hinter der Mauer getan habe, einer
großen Kantate nach einem Text von Christian Lehnert, die anlässlich des
20. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung mit dem RIAS Kammerchor
und dem Ensemble musikFabrik uraufgeführt wurde.“
Nina Rohlfs, 04/2012