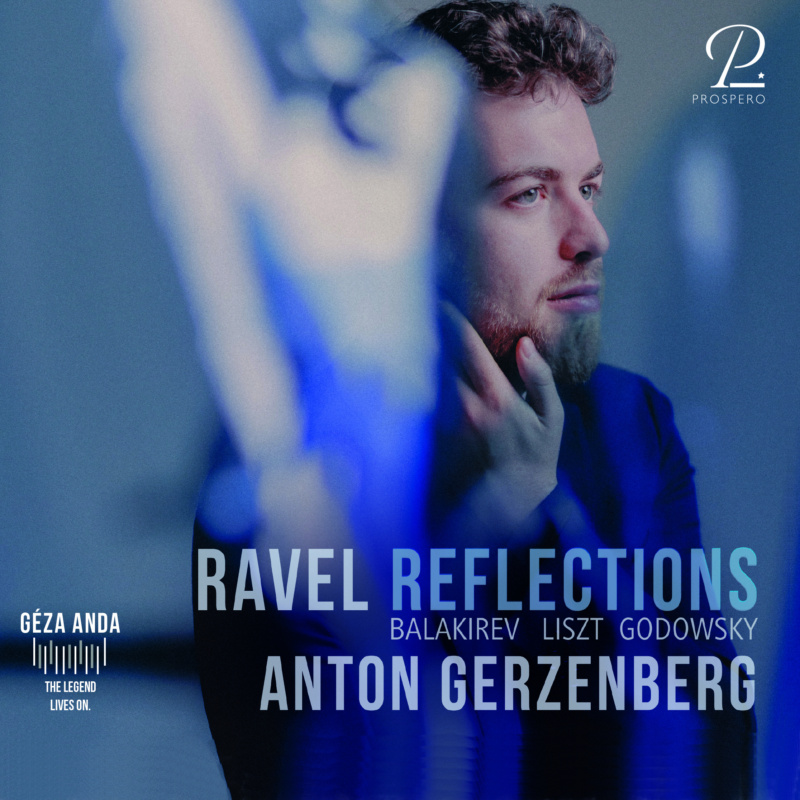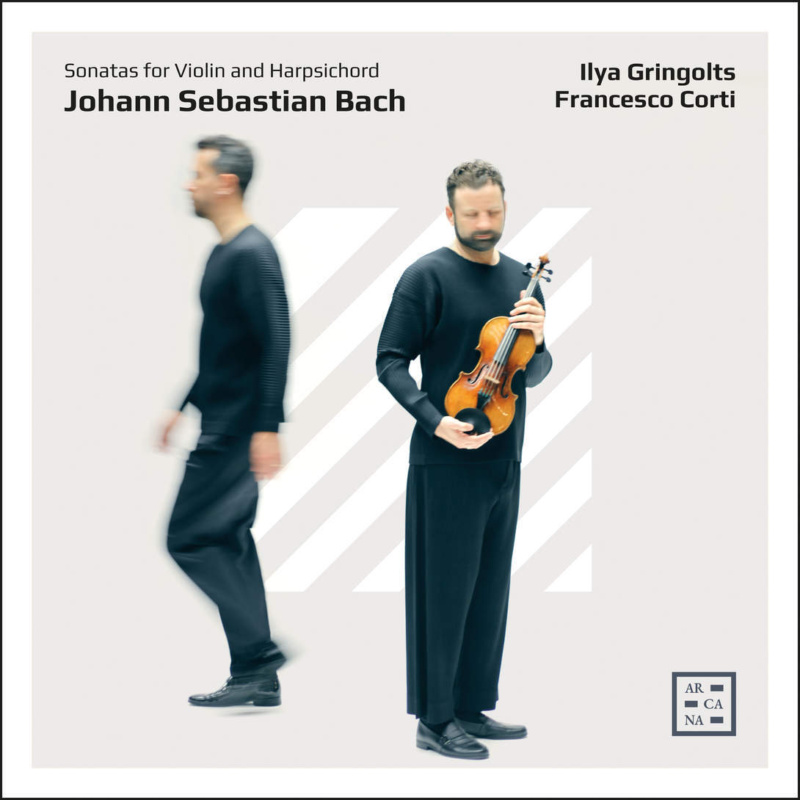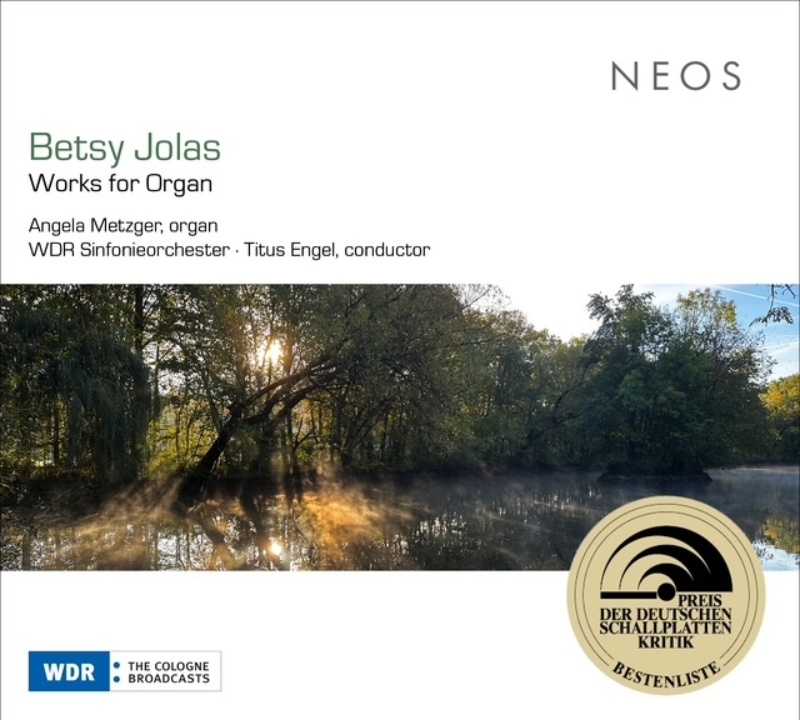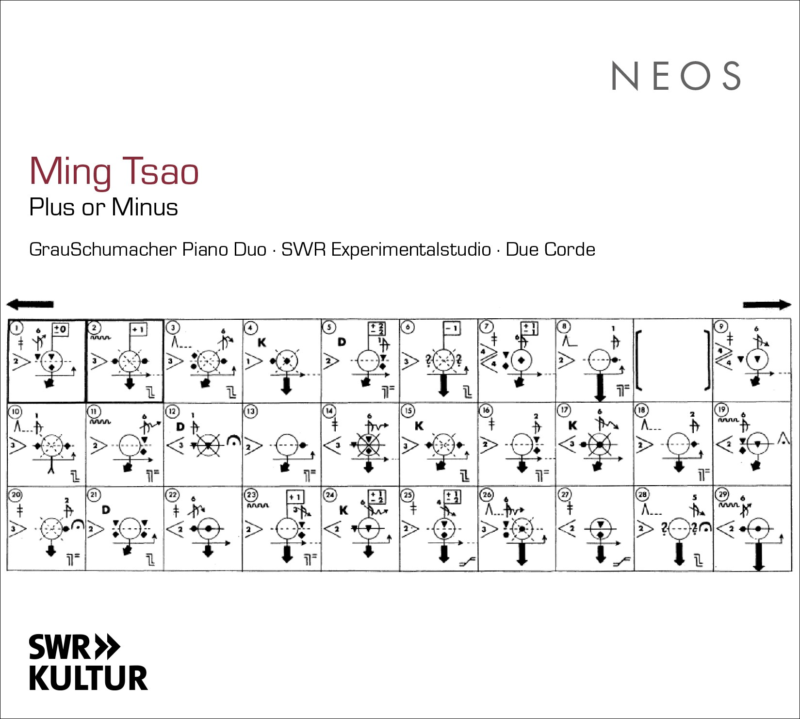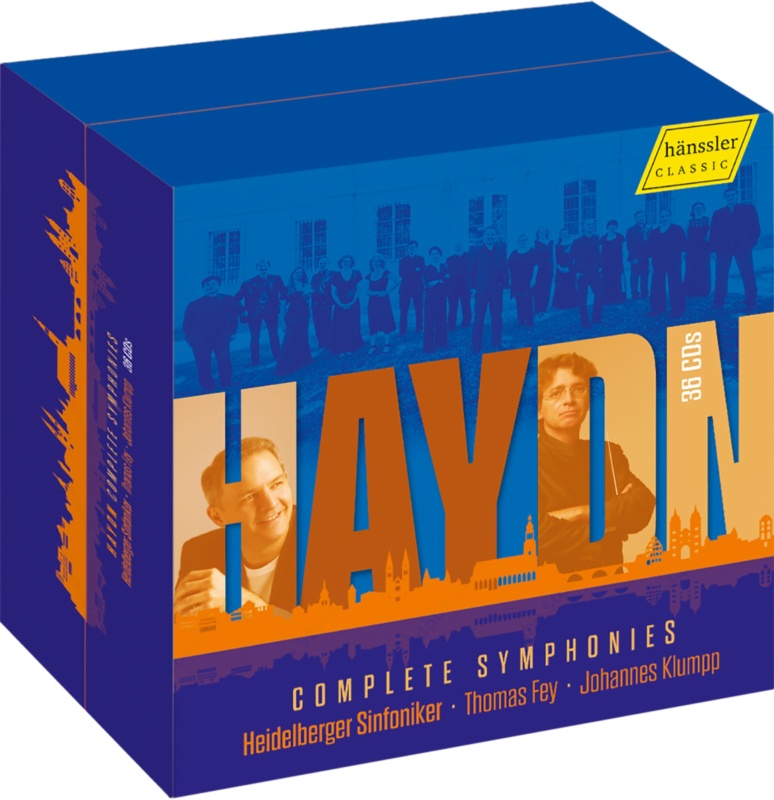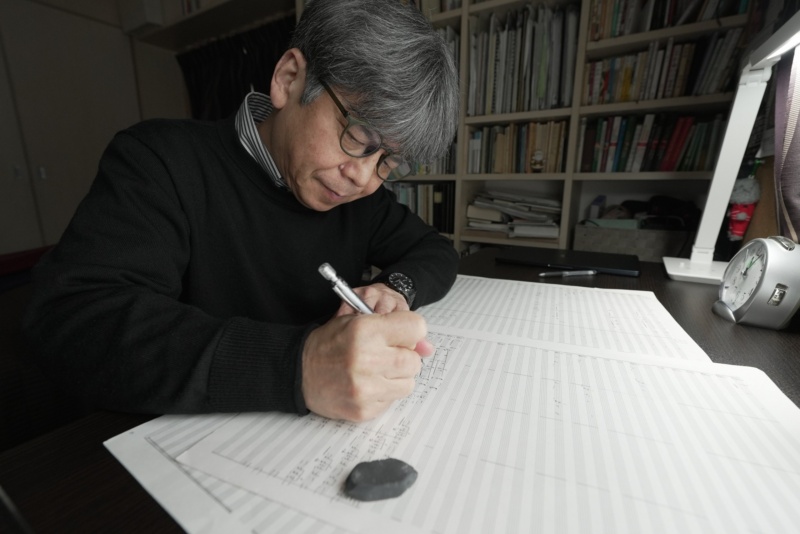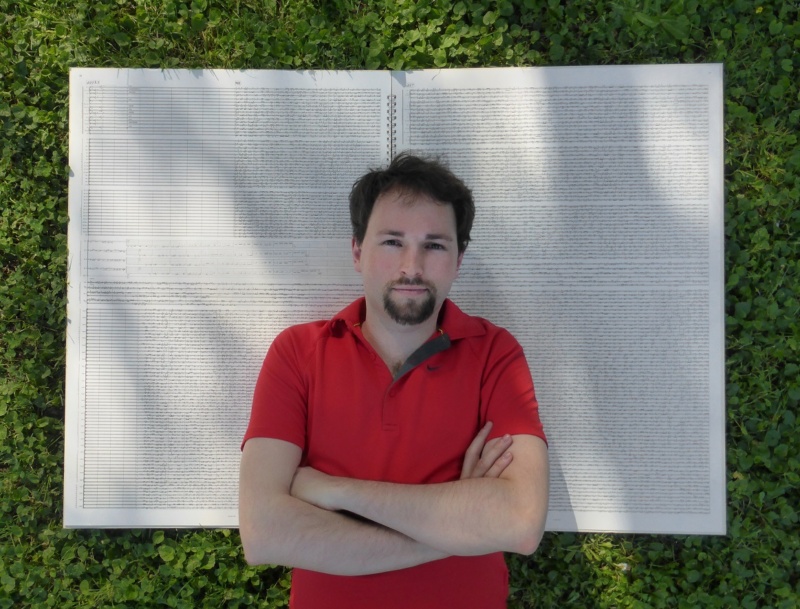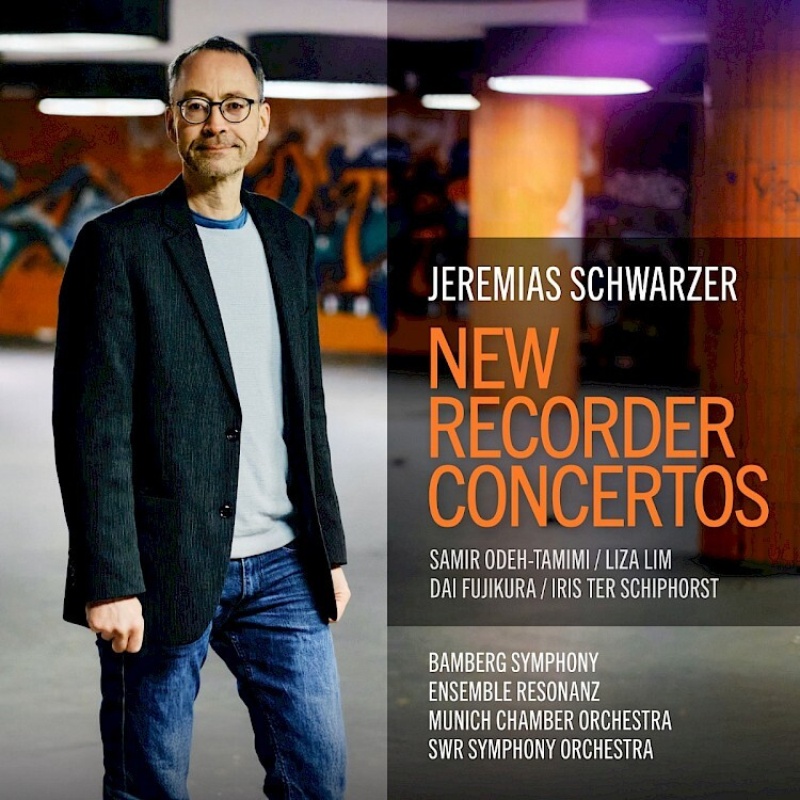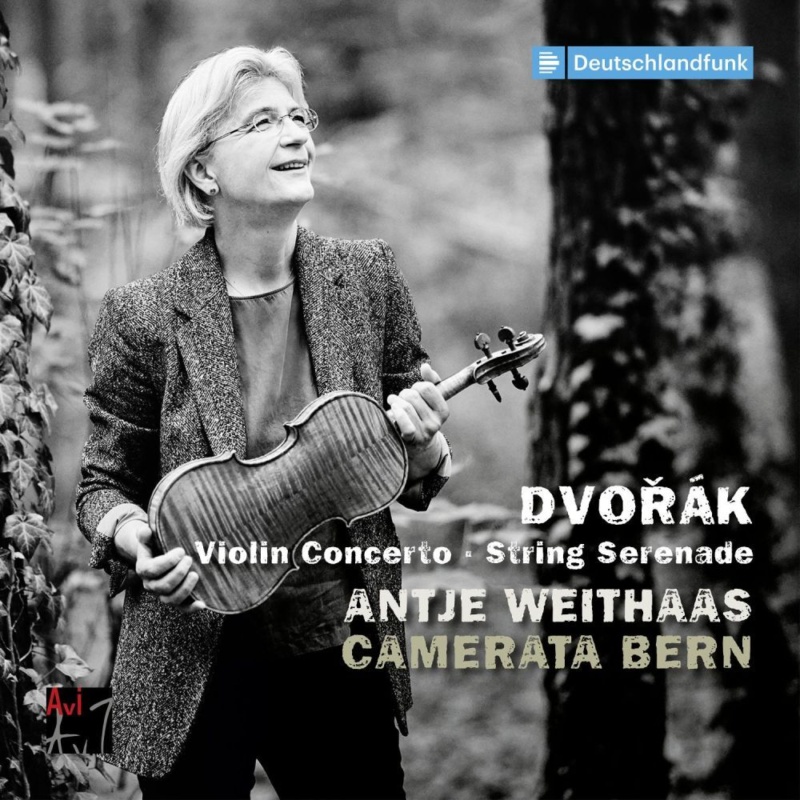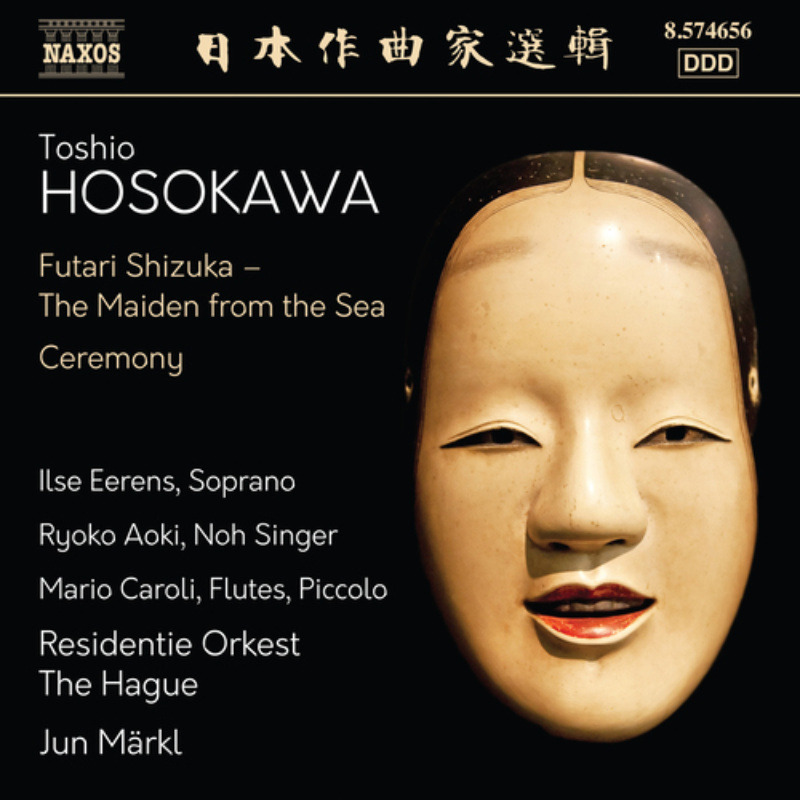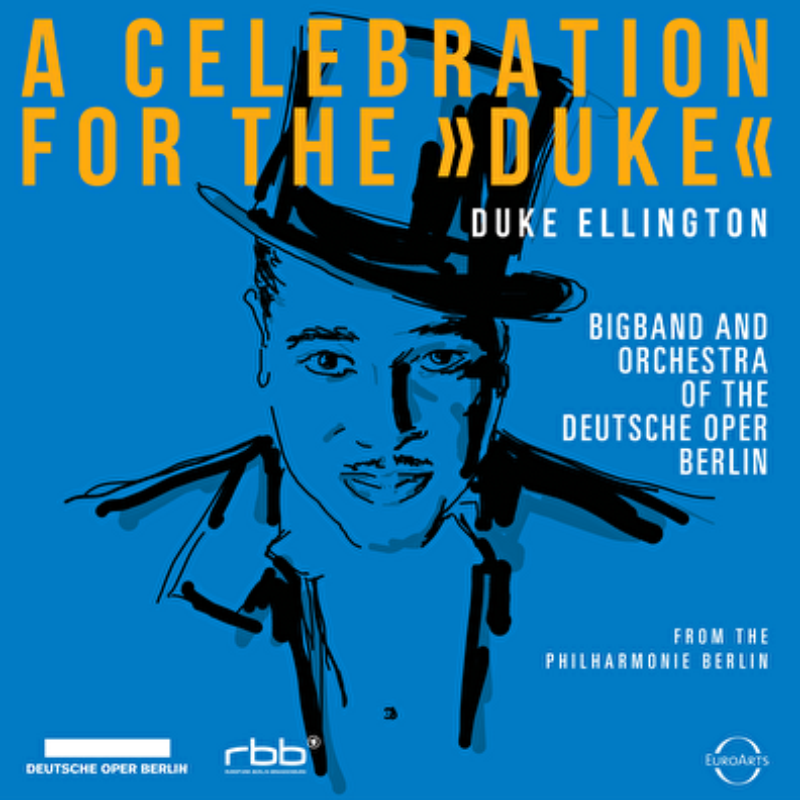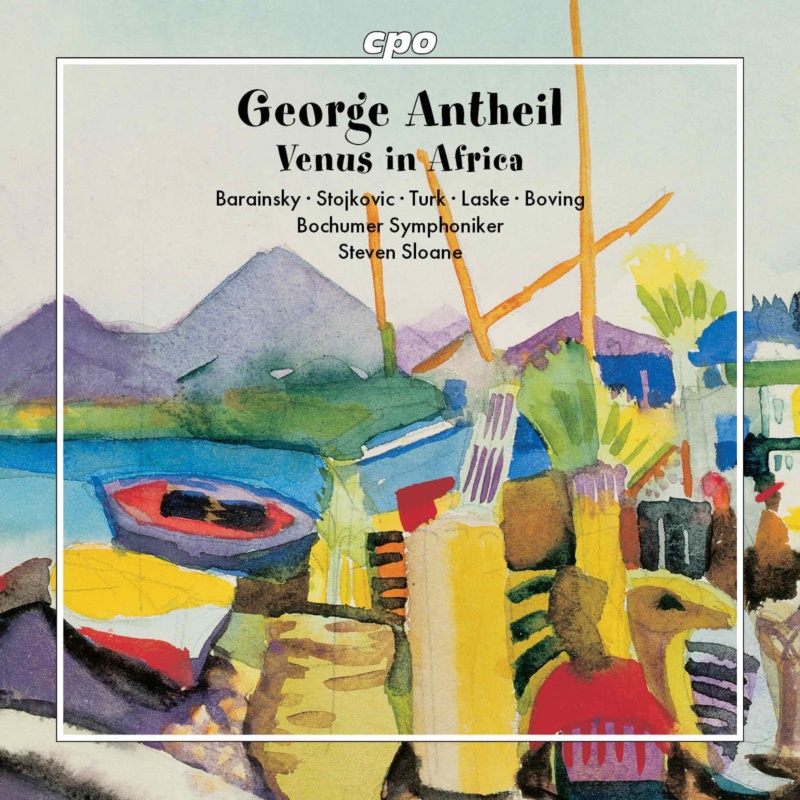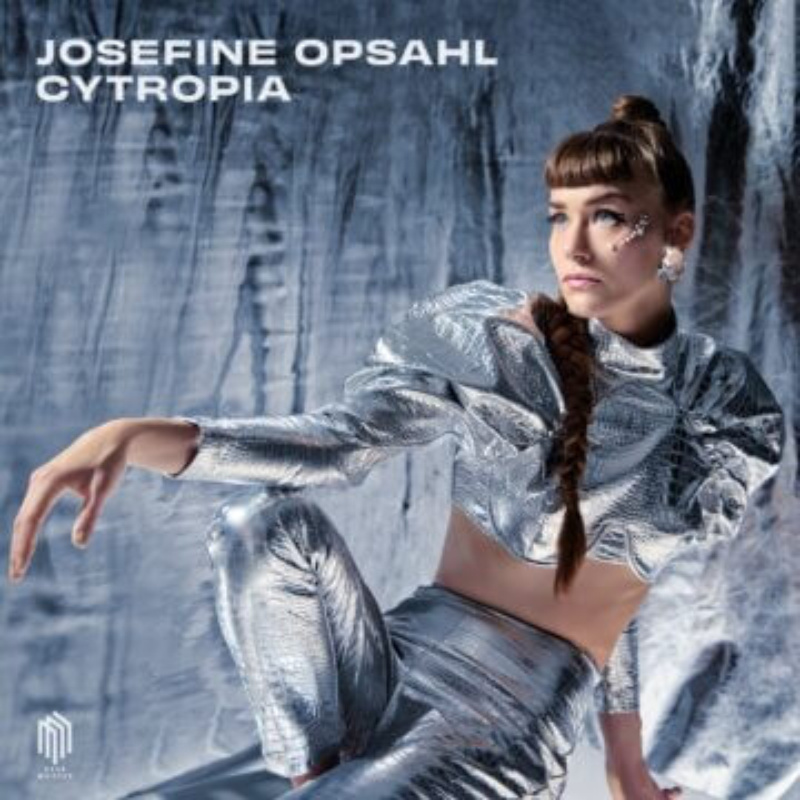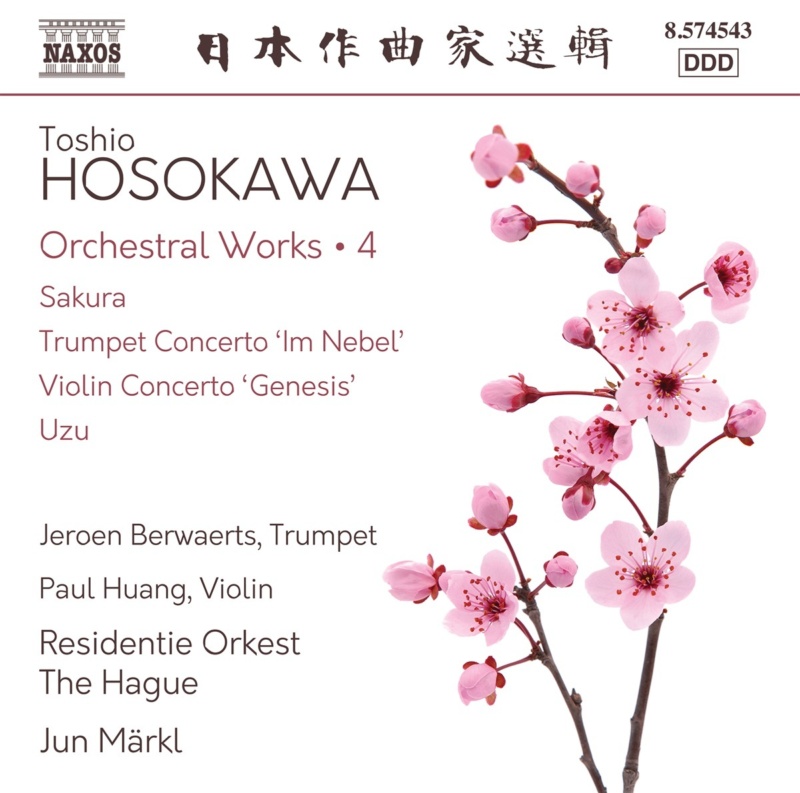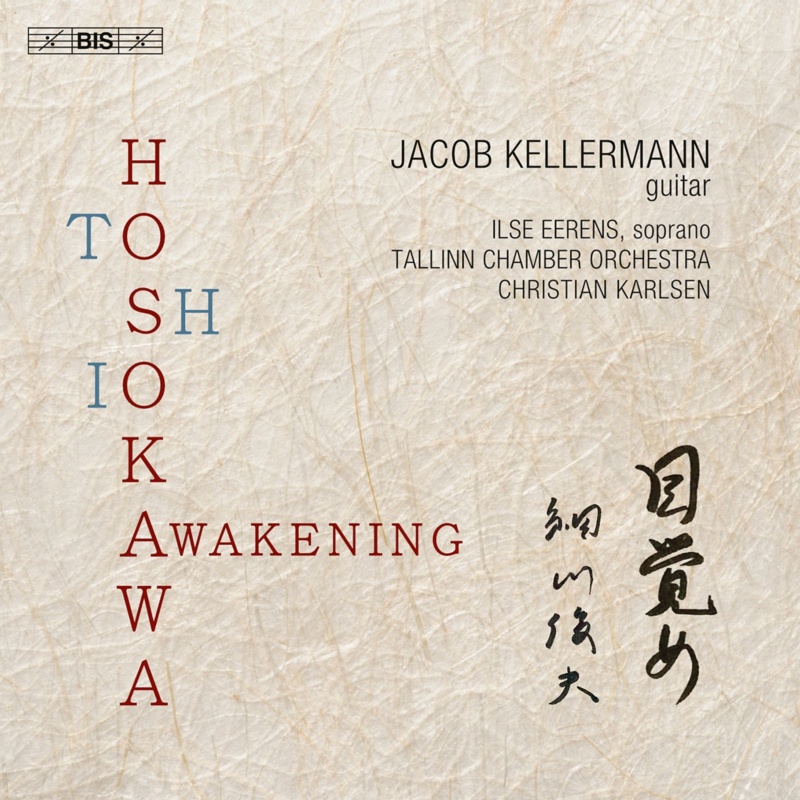Das Kuss Quartett setzt mit seiner anspruchsvollen konzeptionellen Programmgestaltung seit vielen Jahren neue Maßstäbe. Sowohl Klassikfans als auch neuen Publikumskreisen möchte es dabei einmalige Erlebnisse bieten. Wir sind gespannt darauf, das Quartett ab sofort auf diesem Weg zu begleiten und heißen es herzlich willkommen!
mehrWir freuen uns, ab sofort für das Kuss Quartett zu arbeiten, das in der ersten Dezemberwoche viermal im Berliner Radialsystem zu erleben ist: Leoš Janáčeks Streichquartette stehen dort in einer Inszenierung des Musiktheater-Ensembles Nico and the Navigators im Fokus.