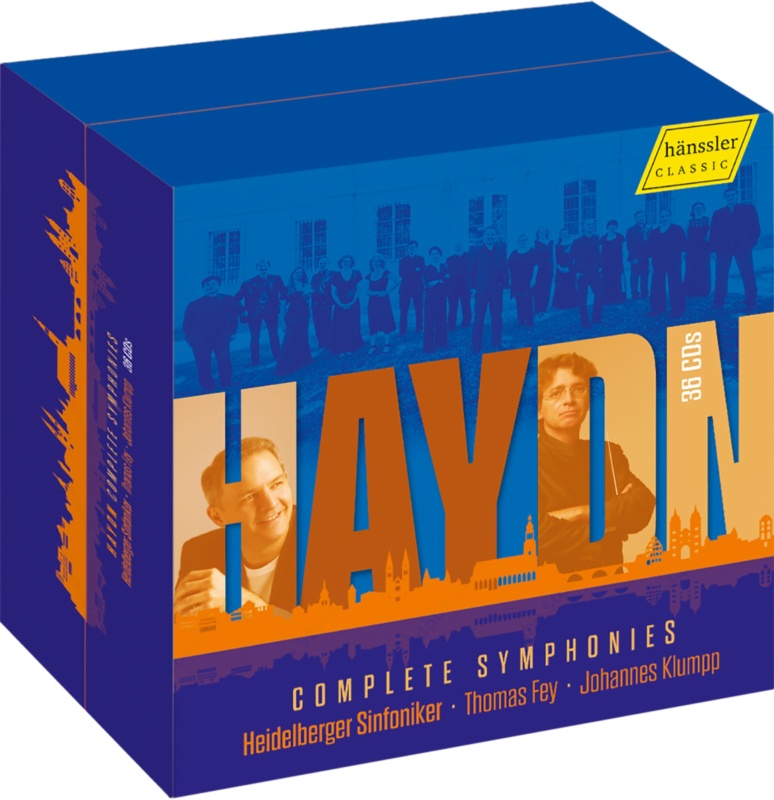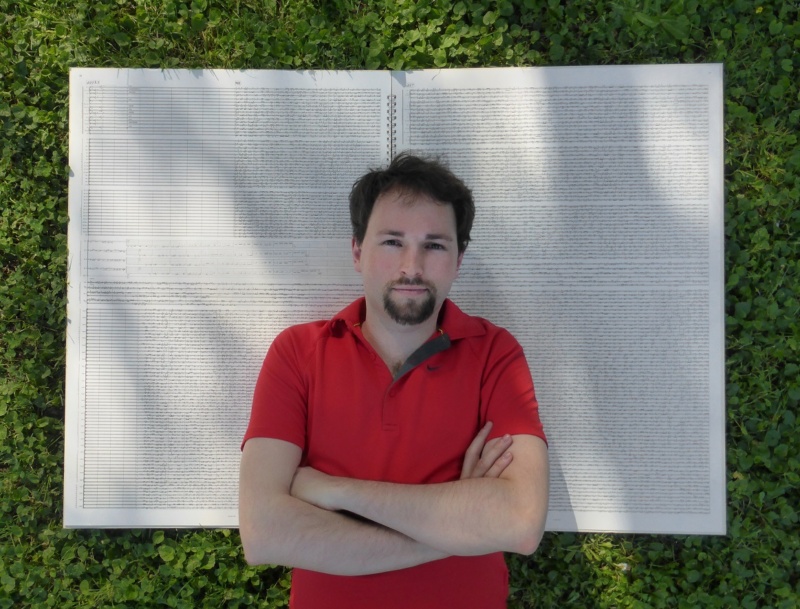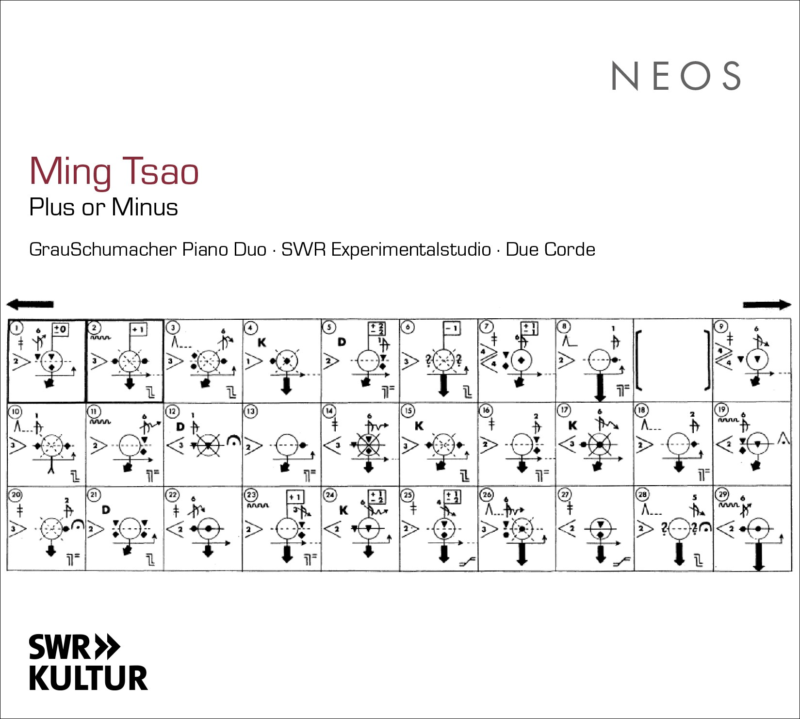Das Bild ist hochformatig – extrem hochformatig. Blau, Braun- und Grüntöne bilden Felder, auf einen ersten Blick scheinen schwarze Leisten die Felder zu begrenzen, doch auf einen zweiten Blick fällt auf, dass diese Leisten eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen: Mitunter begrenzen sie Flächen, mitunter schaffen sie neue Felder. Fünf schraubenartige Metallobjekte heben sich schon wegen des Materials von der durch Holz und Farbe bestimmten Umgebung ab, ein gelber Untergrund, an Gloriolen erinnernd, zwingt sie nachdrücklich ins Blickfeld des Betrachters.
Der Künstler, der 1987 dieses Bild geschaffen hat, hätte sich auch als Maler durchgesetzt. Friedrich Cerha aber ist eine der prägenden Gestalten der österreichischen Musik nach 1945. Am 17. Februar wird Cerha, 1926 in Wien geboren, 90 Jahre alt. Ihm zu Ehren veranstaltet die Donau-Universität Krems ein Symposion, und das Forum Frohner zeigt unter dem Titel Sequenz & Polyvalenz bildnerische Arbeiten Cerhas.
Doppelbegabungen wie er sind selten. In der Regel ist die andere Kunst stets mehr oder weniger als Hobby zu erkennen, auch, wenn der Künstler selbst vielleicht anderer Meinung sein sollte. Echte Doppelbegabungen wie die Dichter-Maler William Blake und Victor Hugo oder der Schriftsteller-Komponist E. T. A. Hoffmann sind Jahrhundert-Einzelerscheinungen.
Dass Cerhas Bedeutung vor allem im Bereich der Musik liegt, hängt nicht nur mit der Qualität seines kompositorischen Werks zusammen, sondern auch mit seiner Sonderstellung in der österreichischen Musik nach 1945. Nahezu im Alleingang führte er sie in die Gefilde der Avantgarde.
Schon an der Auswahl seiner Studien ist sein breit gefächertes Interesse zu erkennen: an der Wiener Musikakademie Violine, Komposition, Musikerziehung, an der Universität Wien Musikwissenschaft, Germanistik, Philosophie.
Das musikalische Umfeld, in dem sich Cerha zu Beginn sozialisiert, ist das des Neoklassizismus. Damit hebt sich Cerha vorerst nicht von der nachromantisch bis neoklassizistisch geprägten Musik ab, die österreichische Komponisten nach 1945 schreiben, während in Deutschland bereits eine heftige Auseinandersetzung mit politischen Bezügen geführt wird: Musik, die den Tonartenbeziehungen treu bleibt, gilt den Avantgardisten als Weiterführung der rückwärtsgewandten Pseudo-Ästhetik der Nationalsozialisten, während die Konservativen eine „Zwölftonverschwörung" zur Marginalisierung von Dur und Moll orten.
In Österreich steht Cerha als zunehmend zur Avantgarde neigender Komponist fast alleine da: Karl Schiske (am 12. Februar jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal), Roman Haubenstock-Ramati, Anestis Logothetis – viele sind es nicht. Die Avantgarde kämpft – von Pluralismus ist keine Rede. Man muss Positionen behaupten, auch dann, wenn einige vielleicht unhaltbar sind. Es gehört zur ästhetischen Auseinandersetzung, mit der sich die Kultur des deutschsprachigen Raums nach 1945 reinigt. Wie weit kann man sich ohne nachhaltigen Verlust an Aufführungschancen in der österreichischen Musiklandschaft vorwagen, in der Gottfried von Einems virtuose Mischung aus nach-mahlerscher Melodik und tänzerisch vitaler Rhythmik als Gipfel der Verwegenheit gilt?
Diese mangelnden Aufführungschancen im Normalbetrieb der Orchester und Ensembles mögen den Ausschlag gegeben haben: 1958 gründet der stets neugierige Cerha mit dem damals ebenfalls noch neugierigen Kurt Schwertsik das Ensemble "die reihe". Schon die Kleinbuchstaben (zu jener Zeit Kultschreibung derer, die ganz vorne mit dabei sein wollten) signalisieren: Hier geht’s ums Neue. Oder vielmehr um jene Musik, die von den Nationalsozialisten verdrängt worden war. Cerha stellt nicht nur die Werke der wenigen österreichischen Avantgardisten zur Diskussion, vor allem arbeitet er als Interpret die Musik von Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton von Webern auf.
Speziell Webern wird für Cerha zur befruchtenden Entdeckung – ganz konsequent vollzieht er den weiteren Schritt zur seriellen Musik, in der sämtliche Parameter, also beispielsweise Tonhöhen, Tondauern und Dynamik vor der Niederschrift vom Komponisten fixiert werden, der Komponist sich also mehr oder minder vollständig seinem Material unterwirft.
Während sich die Serialität speziell in Deutschland und Frankreich zum Popanz der Neuen Musik aufbläht, schlägt Cerha scheinbar isolationistisch einen völlig anderen Weg ein: Seine Musik besteht nun aus Klangflächen, die ineinander fließen oder kontrastierend einander gegenübergestellt werden. Als der ungarische Komponist György Ligeti 1956 vor den Repressionen der Kommunisten nach Wien flieht, trifft er hier auch auf Cerha. Das gegenseitige Interesse ist groß. Jeder will sehen, woran der andere arbeitet. Cerha zeigt Ligeti die Partitur der Spiegel, Ligeti Cerha die der Atmosphères – groß ist das Erstaunen. „Du schreibst meine Musik", soll Cerha, so will es die Anekdote, ausgerufen haben.
Spiegel, sieben Stücke für sehr großes Orchester, 1972 fertiggestellt, abendfüllend: Ein Hauptwerk Cerhas, ein Hauptwerk der Neuen Musik. Monomanische Klangskulpturen. Musik, von der man meint, man könne sie mit den Händen angreifen.
Musik freilich auch, die man so nur ein Mal schreiben kann, ohne in Selbstkopien zu stagnieren.
Als Cerha in den Siebzigerjahren von seinem Verlag, der Universal Edition, den Auftrag bekommt, Alban Bergs unvollendete Oper Lulu zu komplettieren, gleicht das einem Befreiungsschlag (und beweist, welchen Einfluss ein Verleger, im konkreten Fall die überragende Gestalt des Alfred Schlee, auf die Musikgeschichte nehmen kann). Cerha erfährt bei der Arbeit an der Instrumentierung und den von Berg nicht auskomponierten Stellen die Kunst der Synthese. Nicht, dass Cerha nun Berg nachahmen würde (obwohl Einflüsse zu merken sind), doch die Synthese der ihm zugänglichen Möglichkeiten führt zum noch avantgardistischen Musiktheaterstück Netzwerk und weiter zu den vollblütigen echten Opern Baal, Der Rattenfänger, Der Riese vom Steinfeld und Onkel Präsident.
Dass Cerha 1988 im Momentum für Karl Prantl einen Bildhauer würdigt, ist keine leere Geste: Prantls Zeichensetzungen in Stein und Cerhas plastische Musik sind enge Verwandte geblieben, auch wenn Cerha sich mittlerweile wieder der Thematik und der (oft berückend sinnlichen) Melodik bedient und etwa im Requiem für Hollensteiner zu herbstlich getönter, fast möchte man sagen: Romantik findet, wenn das Wort bei Werken der zeitgenössischen Musik mit Kitsch konnotiert wäre.
Und kitschig ist Cerha nicht einmal dann, wenn er in seinen Keintaten das Wienerlied lustvoll seziert. Dass daneben sein Streichquartettschaffen, für das er sich von außereuropäischen mikrotonalen Systemen anregen lässt, schwerer wiegt, versteht sich von selbst.
Er ist zum modernen Klassiker geworden, dieser einst als Avantgardist scheel beäugte Friedrich Cerha. Seine Sonderstellung, die er stets in der österreichischen Musik einnahm, hat er freilich auch in einem weiteren Punkt behalten: Er ist einer der wenigen Propheten, die noch zu Lebzeiten im eigenen Land Geltung errangen. Und das ist gut so.
Edwin Baumgartner
Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung der Wiener Zeitung