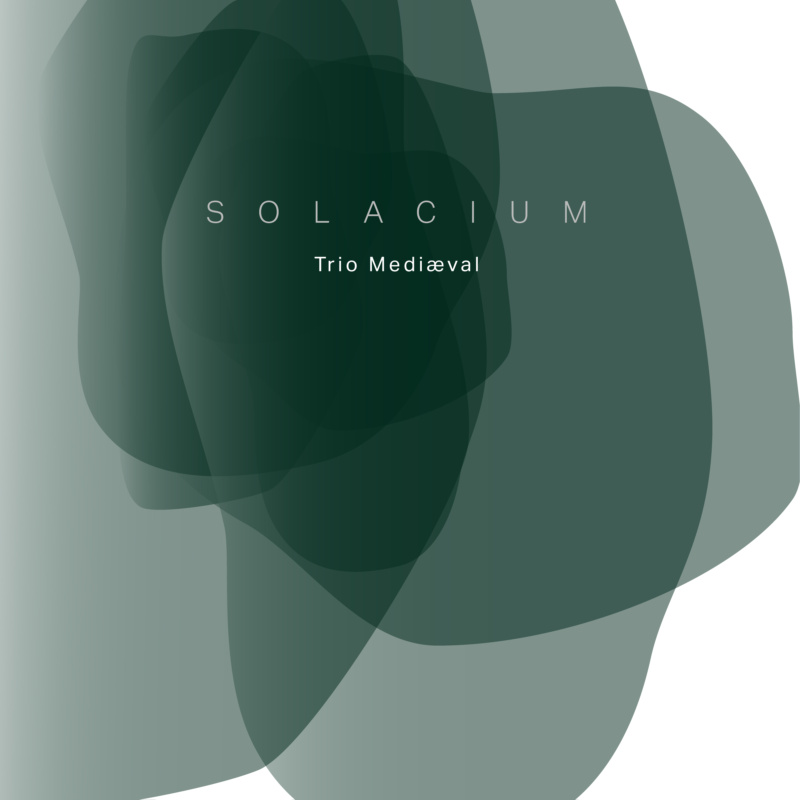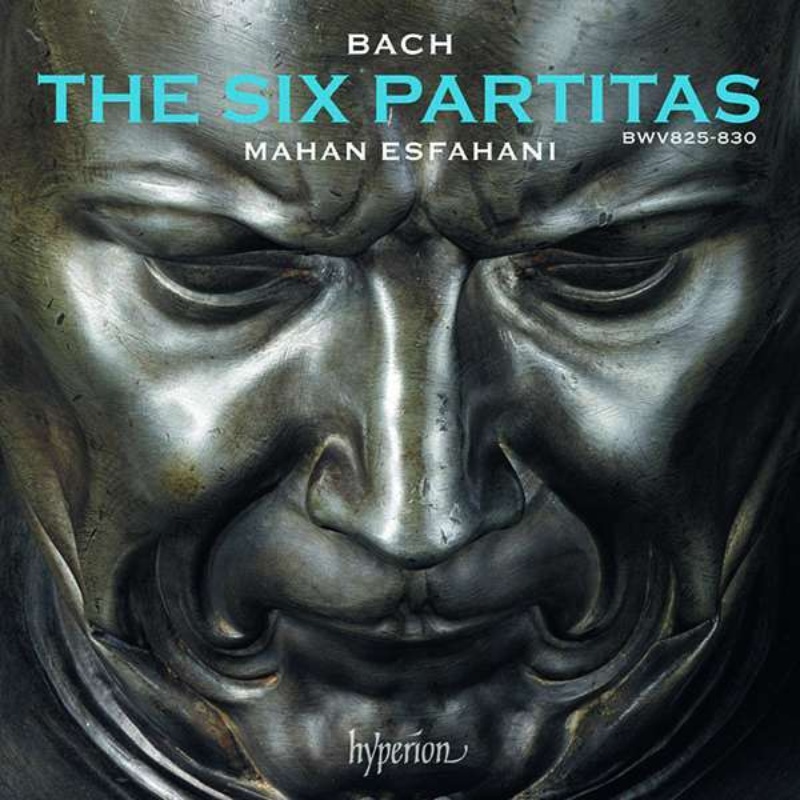Vorbei am Musik- und Komponierzimmer führt Ming Tsao zum Gespräch in das „Berliner Zimmer”. Das für die Gründerzeitarchitektur der Stadt typische langgezogene Verbindung zwischen Vorderhaus und Seitenflügel dient als Wohnzimmer und, mit Regalen bis unter die Stuckdecke, Bibliothek. Der kleine Bezirk Friedenau, in dem die Wohnung liegt, atmet Geschichte – Schriftsteller wie Erich Kästner, Uwe Johnson, Günter Grass lebten hier, durchaus bürgerlich auch Rosa Luxemburg, und Joseph Goebbels verfasste seine Hassreden quasi Tür an Tür mit dem Widerstand, der ebenfalls hier eine Hochburg hatte.
Ming Tsao schätzt es, dass Geschichte, dass Tradition in seiner Wahlheimat auf Schritt und Tritt spürbar sind, auch in Bezug auf die Musik. „Das Problem mit der klassischen Musik in den USA ist, dass sie immer irgendwie ein künstliches Konstrukt bleibt“, merkt er an und beginnt, von seinem eigenen musikalischen Werdegang zu erzählen. Der startete früh mit der Ausbildung an der Violine, auf Betreiben seiner amerikanischen Mutter, deren Vater ein Geiger aus Wien war. Mit ihrem chinesischen Mann war sie ins kalifornische Berkeley gezogen, zu einer Zeit, in der ihre Ehe in vielen anderen Teilen der USA illegal gewesen wäre. „In der High School begann ich, mich für Jazz zu interessieren, denn die Jazzmusiker waren diejenigen, die wirklich tiefgehend über Musik sprachen“, fährt Ming Tsao fort. Seine ersten Stunden auf dem E-Bass erhielt er von dem berühmten Fusion-Gitarristen Joe Satriani, der in der Nachbarschaft unterrichtete. „Am Berklee College of Music in Boston studierte ich dann mit Leuten wie den Marsalis Brüdern – Musikern, die von klein auf Jazz gespielt hatten“, erinnert er sich. „Mir wurde klar, dass meine Sache eher Komposition war. Ich mag daran die Langsamkeit – dass man nachdenken und tüfteln kann.“
Als China sich Anfang der 80er Jahre langsam dem Westen öffnete, reiste auch Ming Tsaos Familie häufiger in das Land. “Ich wollte ein chinesisches Saiteninstrument lernen, und mein Vater schlug die Guqin vor, die als ‚Gelehrteninstrument’ gilt, mit einer sehr komplexen Notation. Wir fanden einen berühmten Guqin Musiker, der außerdem Mathematikprofessor war. Während der Kulturrevolution reparierte er Uhren, um seine Finger geschmeidig zu halten, bis er nach der Revolution wieder sein Instrument spielen durfte.“
Die chinesischen Einflüsse tauchten auch mehr und mehr in Ming Tsaos Kompositionen auf. „Ich wollte mich systematischer damit beschäftigen und studierte deshalb Musikethnologie“, so der Komponist. „An der Columbia University in New York belegte ich auch Kurse in elektronischer Musik, noch kurz bevor man die Studios auf digitales Arbeiten umstellte. Es hieß also Tonbänder schneiden und kleben. In den berühmten Columbia Princeton Studios forschten Komponisten wie Milton Babbitt und Vladimir Ussachevsky. Für mich war es ein wichtiger Schritt, mich nicht mehr nur auf die Notation zu verlassen, sondern auf eine mir bis dahin völlig unbekannte Art am Klang zu arbeiten.”
Prägend wurde für den jungen Kompositionsstudenten seine Zeit in San Diego, wohin er auf Anregung von Brian Ferneyhough ging – seinem einflussreichsten Lehrer in dieser Zeit. „Ich besuchte einen Sommerkurs bei ihm, der mein Denken über Komposition komplett umkrempelte. Er überzeugte mich, bei Null anzufangen. Bis dahin war meine Musik sehr gestisch, die Stücke aus dem Studium hatten noch diesen spätromantischen Bezug. In San Diego begann ich, Stücke mit stark reduziertem Material zu schreiben, auch aus praktischen Gründen, um mit geräuschhaften, raueren Klängen umgehen zu können. Noise-Elemente haben schnell die Tendenz, rein dekorativ zu klingen, wenn sie in Kontakt mit anderen Materialien kommen.“
Für Ming Tsao bleibt dies eine Grundfrage seiner Kompositionsweise: Wie kann man einen Dialog zwischen Geräusch, Melodie, anderen disparaten Elementen schaffen, wie kann es Interaktion geben, ohne dass eine Hierarchie entsteht? Beispielhaft ist für ihn Helmut Lachenmanns Weg. „Sein Gran Torso ist extrem reduziert; zum 3. Streichquartett hin hat er seine Klangsprache angereichert. Das braucht Zeit und Meisterschaft.“ In San Diego findet Ming Tsao den idealen Nährboden für seine eigene Entwicklung. „Leute wie Chaya Czernowin, Brian Ferneyhough, Philippe Manoury, Roger Reynolds, George Lewis tummelten sich dort. Diese Kombination von europäischer Avantgarde und amerikanischem Experimentalismus war toll, denn der amerikanische Blick bringt eine radikale Offenheit, alles ist dort möglich, während die europäische Perspektive immer berücksichtigt, dass man sich in einem geschichtlichen Kontext, einer Tradition von Aufführungspraxis bewegt.“
Beide Haltungen finden sich heute in der Musik von Ming Tsao wieder. „Ich bringe in meinen Werken Dinge zusammen, die sehr unterschiedlich sind. Ich will einen Kontext schaffen, in dem das krudeste Geräusch mit der kunstvollsten Melodie koexistieren kann. Ein Beispiel dafür ist meine Ausarbeitung von Stockhausens Plus Minus.“ Der 2017 bei Kairos erschienenen Aufnahme dieser Umsetzung folgt demnächst beim Label Neos eine CD mit der zweiten Ausarbeitung, betitelt Plus or Minus. „Ich will nicht konservativ klingen, aber Kontrapunkt ist sehr wichtig: Wenn sich die Elemente in einem engen Kontrapunkt bewegen, halten sie einander. Und sie widerstehen damit der Idee von Hierarchisierung. Polyphonie erlaubt Diversität. Sie ermöglicht vielfältigen Stimmen aufzutauchen, zu interagieren. Dabei geht es für mich nicht so sehr um das Material, sondern um den Hör-Raum, den wir schaffen.“
Auch mit den Triode Variations, die vom Ensemble Musikfabrik unter Emilio Pomàrico in Köln aus der Taufe gehoben wurden und in Kürze vom Label Kairos auf CD veröffentlicht werden, verfolgt Ming Tsao einen Prozess der Dehierarchisierung. Die kompositorische Strategie des Stückes klingt zunächst kompliziert. Sie zielt dennoch nicht auf elfenbeinturmhafte Abgehobenheit, sondern auf die Unmittelbarkeit der Erfahrung. Grundlage sind Schönbergs Variationen für Orchester, die nach dem Modell elektronischer Trioden verfremdet und mit der metrischen und rhythmischen Struktur eines Gedichtes von J. H. Prynne überlagert werden. „Schönbergs Komposition ist ja schon ein Sprung, sie destabilisiert die Verhältnisse. Aber Schönberg schreibt das hörende Subjekt in die Musik ein – es gibt den spätromantischen Gestus, mit seinem Rhythmus, seiner Phrasierung, den schon Boulez kritisiert hat. Obwohl die Variationen ins Extrem dessen gehen, was möglich erscheint, bleibt in ihnen eine Perspektive, aus der wir die Dinge in Zusammenhang bringen. Ich frage nun: Was, wenn das nicht mehr möglich ist? Wenn wir in einer chaotischen und komplexen Welt keine Anker für unser Verständnis mehr haben? Das ist für mich das materialistische Projekt: Die Anker zu entfernen, die uns Interpretation ermöglichen. Denn Interpretation hält uns davon ab, die Musik unmittelbar zu erfahren. Erst ohne sie sehen wir den Reichtum, werden unsere Sinne geschärft.“
„Bei Schönberg entsteht das zentrale Subjekt über Emotion, bei Lachenmann über Klangsinnlichkeit“, so Ming Tsao weiter. „Ich habe nicht den Luxus, solch ein Subjekt in die Musik zu schreiben – ich stehe durch mein chinesisches Erbe sowieso mit einem Fuß außerhalb dieser Traditionen, und in den USA ist man weit davon entfernt. Ich muss mich anders annähern.“
Der eine Fuß in der chinesischen Kultur dient ihm dabei durchaus als Brücke in eine andere Form der Expressivität. „Ausdruck in der chinesischen Musik ist anders, nicht so subjektiv geprägt. Es gibt für mich eine Verbindung zu Brechts Verfremdungseffekt, den er ja tatsächlich durch seine Begegnung mit chinesischer Kultur, chinesischer Oper entwickelt hat. Es geht nicht um Emotionalität, um das Einfühlen in einen Charakter, sondern um das Zeigen, das Zitieren.“
Der Komponist schreibt momentan an einer äußerst vielschichtig konzipierten Oper nach einem Libretto aus multiplen Stimmen, in dem auch Bertolt Brecht eine Rolle spielt. In diesem Werk – die Uraufführung ist für 2024 geplant – fließen viele der Dinge zusammen, die sich schon jetzt in seinem Schaffen manifestieren. Ein weiterer Schritt in Ming Tsaos „materialistischem Projekt“, über das er sagt: „Wenn wir aufhören, das Material in die Logik unserer Assoziationen zu zwängen, müssen wir die Dinge sehen, wie sie sich uns zeigen. Für mich hat das eine politische Dimension: Es bringt die Hörer und Hörerinnen dazu, der Welt offener zu begegnen.“
Nina Rohlfs, 5/2022
Zum Weiterlesen: Ming Tsao über sein "materialistisches Projekt" in der Zeitschrift MusikTexte 175, November 2022